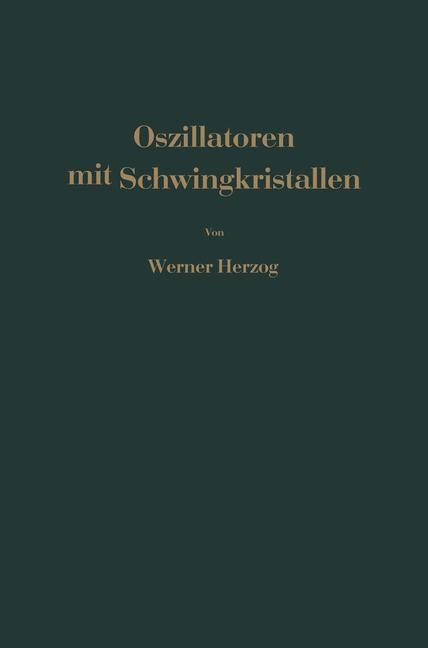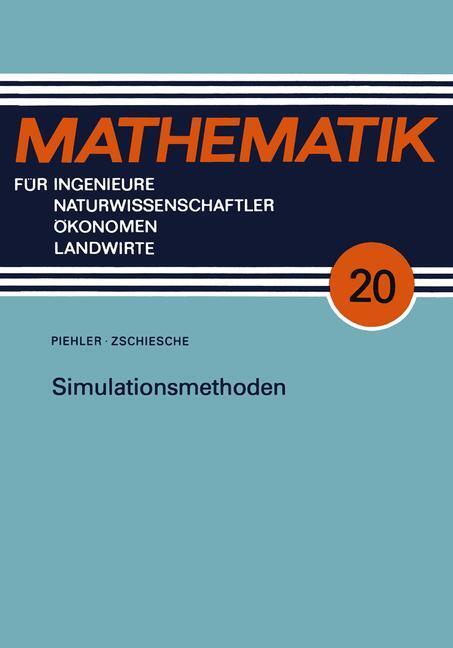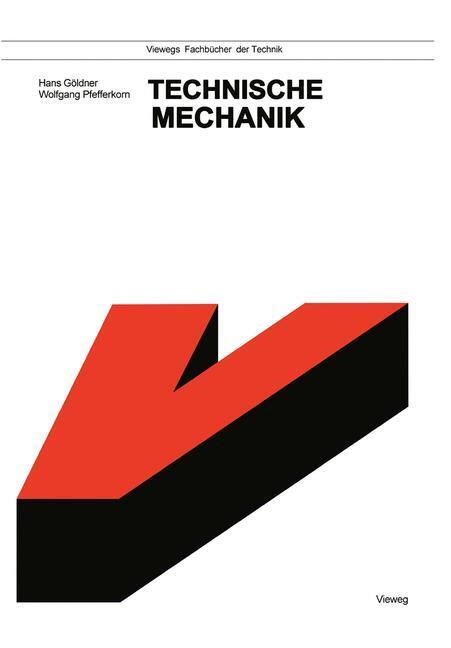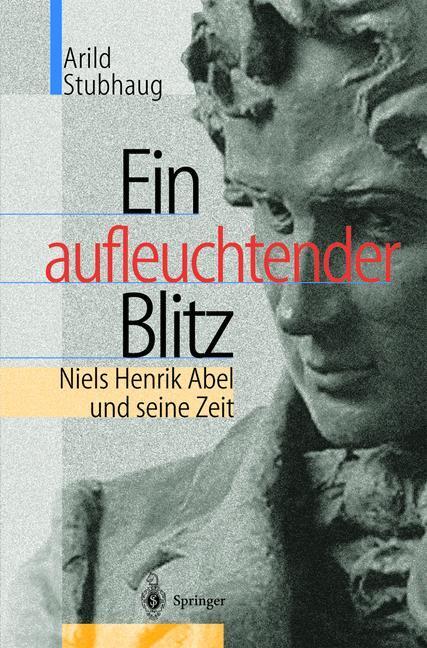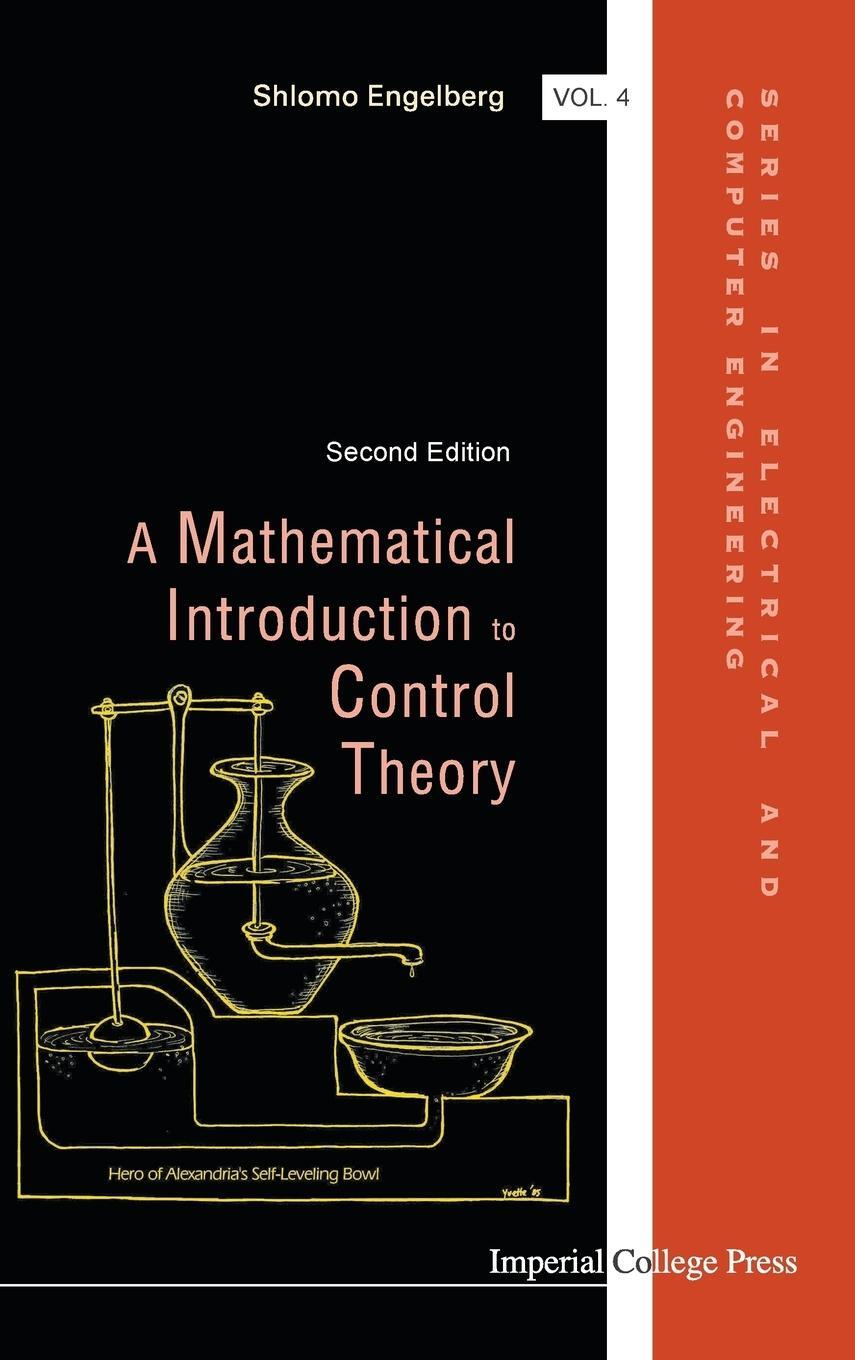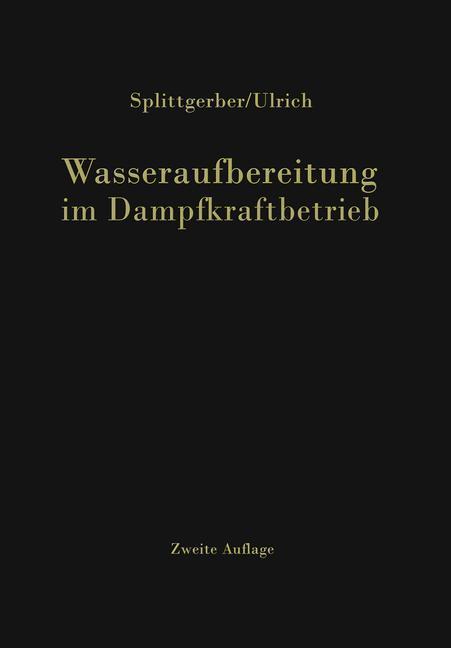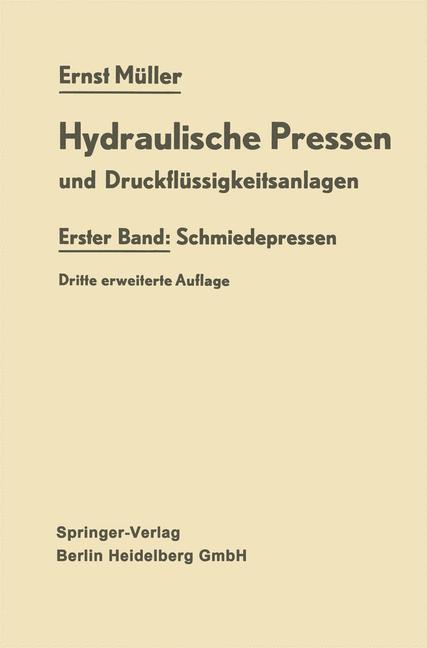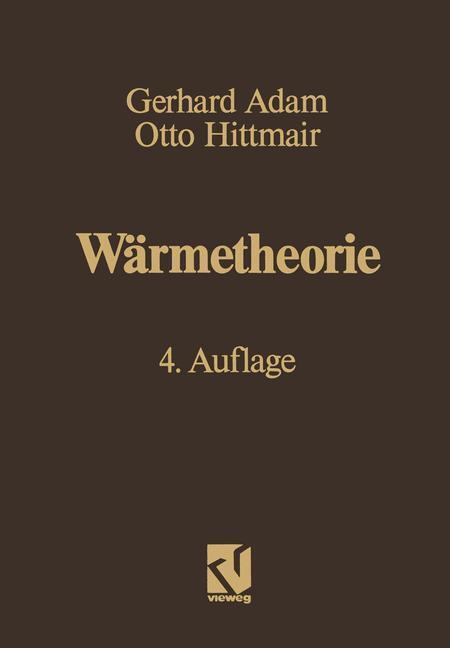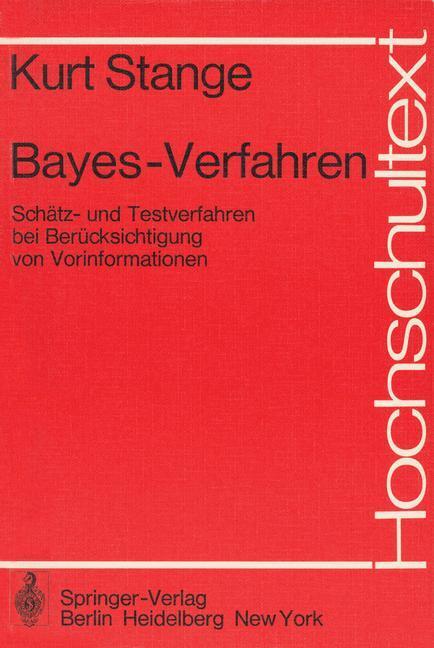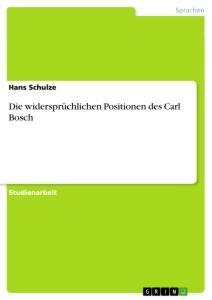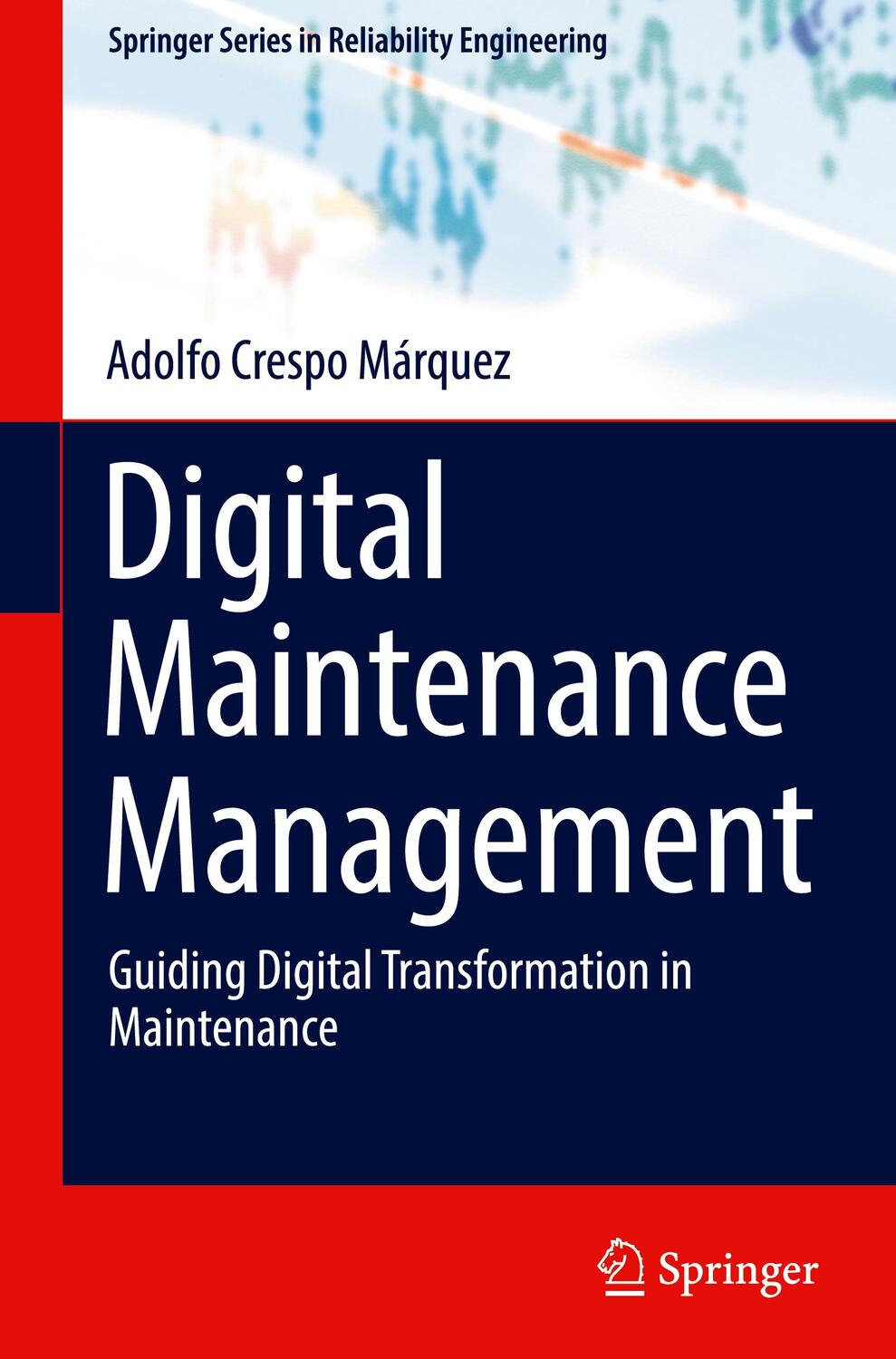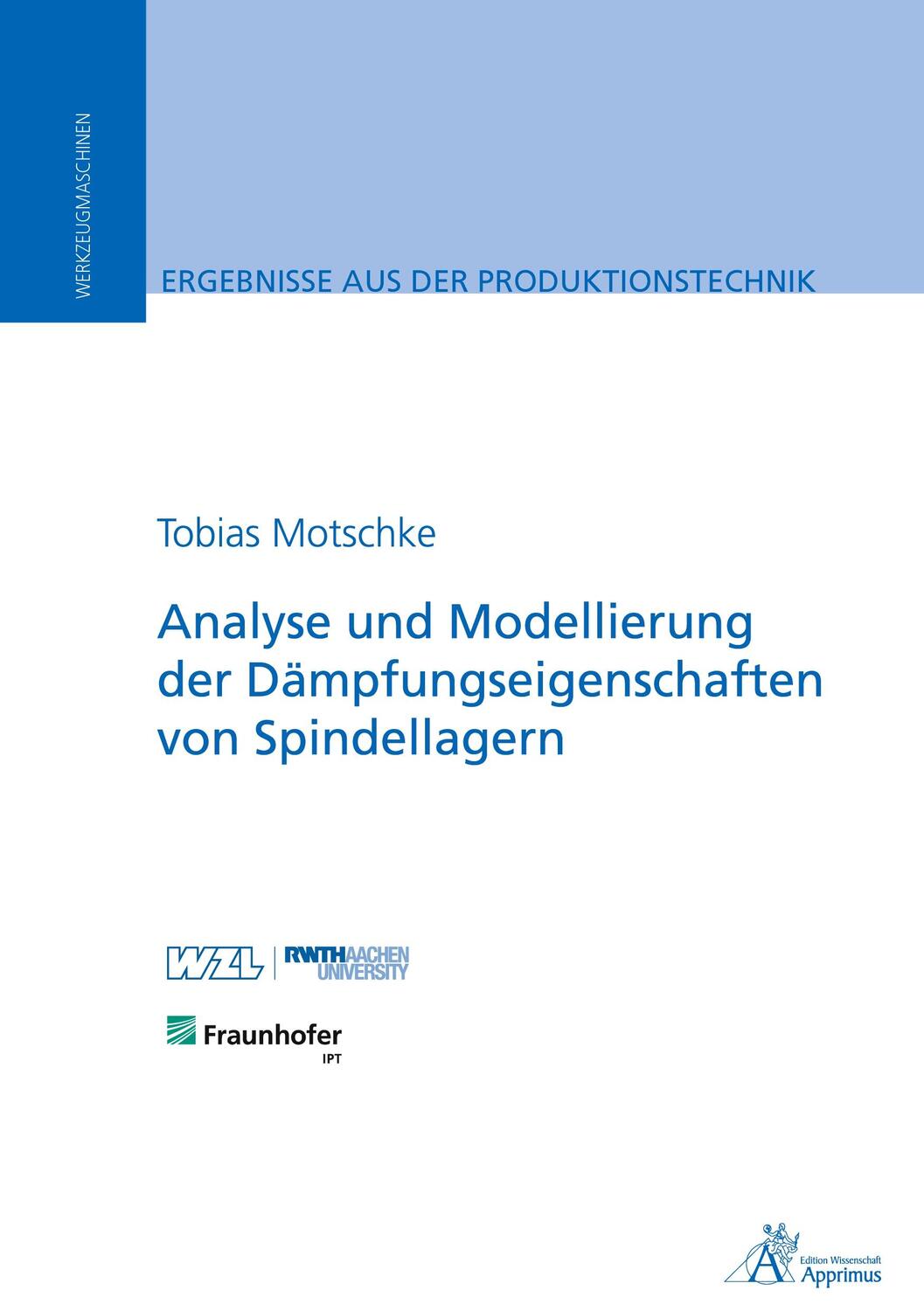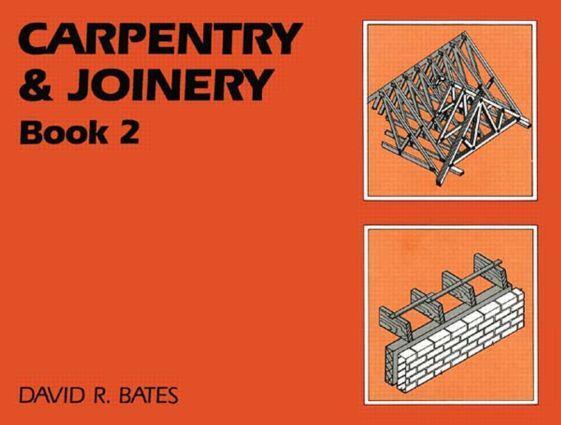Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Deutsch
54,99 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 4-7 Werktage
Kategorien:
Beschreibung
Die Anwendung von Schwingkristallen in Oszillatorschaltungen war infolge der hervorragenden Eigenschaften derselben ein derartiger Erfolg, daB man lange Zeit mit wenigen Schaltungen auskam. Die mit einfachen Mitteln erzielbare Frequenzkonstanz war zur Steuerung der Rundfunksender in jeder Weise ausreichend. Selbst die hohen An forderungen, die der Gleichwellenfunk an die Konstanz der Steuer oszillatoren stellte, konnten ohne besondere Schwierigkeiten erfiillt werden. Mit sorgfaltig aufgebauten Oszillatoren - den sogenannten Kristalluhren - war es moglich, die Konstanz noch weiter zu erhohen. Aus vergleichenden Messungen entstand die Frage, ob die Abweichun gen der astronomisch gemessenen Zeit von der Zeit der Kristalluhren nicht auf Mangel der Uhren, sondern auf Abweichungen in der Regel miiBigkeit der Erdumdrehung zuriickzufiihren seien. Damit war ein zunachst rein wissenschaftliches Interesse an der Erhohung der Kon stanz gegeben. Doch auch die Funktechnik konnte fiir genaue Mes sungen hohere Konstanz gebrauchen. In den Briickenoszillatoren wurden Schaltungen gefunden, die eine wesentliche Konstanzver besserung zulassen. Nun schien eine Entdeckung, welche die Schwin gungen im Atom ausnutzt - die sogenannte Atomuhr - eine weitaus hohere Konstanz zu ermoglichen. Die Realisierung der theoretischen Betrachtungen ergab jedoch groBe Schwierigkeiten und zunachst keine hohere Konstanz als Kristalluhren. Nach einer neuesten Mitteilung ist 10 mit einer Casiumuhr eine Konstanz von 5· 10- erreicht worden. Mit weiteren Verbesserungen der Kristalloszillatoren, insbesondere des Rohrenteiles und der Eliminierung der Verluste, dib. :fj&n die Kristall uhren in der Konstanz mit den Atomuhren konkurrieren konnen.
Die Anwendung von Schwingkristallen in Oszillatorschaltungen war infolge der hervorragenden Eigenschaften derselben ein derartiger Erfolg, daB man lange Zeit mit wenigen Schaltungen auskam. Die mit einfachen Mitteln erzielbare Frequenzkonstanz war zur Steuerung der Rundfunksender in jeder Weise ausreichend. Selbst die hohen An forderungen, die der Gleichwellenfunk an die Konstanz der Steuer oszillatoren stellte, konnten ohne besondere Schwierigkeiten erfiillt werden. Mit sorgfaltig aufgebauten Oszillatoren - den sogenannten Kristalluhren - war es moglich, die Konstanz noch weiter zu erhohen. Aus vergleichenden Messungen entstand die Frage, ob die Abweichun gen der astronomisch gemessenen Zeit von der Zeit der Kristalluhren nicht auf Mangel der Uhren, sondern auf Abweichungen in der Regel miiBigkeit der Erdumdrehung zuriickzufiihren seien. Damit war ein zunachst rein wissenschaftliches Interesse an der Erhohung der Kon stanz gegeben. Doch auch die Funktechnik konnte fiir genaue Mes sungen hohere Konstanz gebrauchen. In den Briickenoszillatoren wurden Schaltungen gefunden, die eine wesentliche Konstanzver besserung zulassen. Nun schien eine Entdeckung, welche die Schwin gungen im Atom ausnutzt - die sogenannte Atomuhr - eine weitaus hohere Konstanz zu ermoglichen. Die Realisierung der theoretischen Betrachtungen ergab jedoch groBe Schwierigkeiten und zunachst keine hohere Konstanz als Kristalluhren. Nach einer neuesten Mitteilung ist 10 mit einer Casiumuhr eine Konstanz von 5· 10- erreicht worden. Mit weiteren Verbesserungen der Kristalloszillatoren, insbesondere des Rohrenteiles und der Eliminierung der Verluste, dib. :fj&n die Kristall uhren in der Konstanz mit den Atomuhren konkurrieren konnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Eigenschaften und Herstellung schwingfähiger Kristalle.- 1.1 Der Piezoeffekt.- 1.2 Das elektrische Ersatzschaltbild des schwingenden Kristalls.- 1.3 Kristalle mit piezoelektrischem Effekt.- 1.4 Kristall und Schaltung.- 2 Zur allgemeinen Theorie der Oszillatoren.- 2.1 Vorbemerkungen.- 2.2 Die Differentialgleichung des Oszillators.- 2.3 Die komplexe Darstellung.- 2.4 Der Zusammenhang über die Schaltung.- 2.5 Der Zusammenhang über die Röhre. Schwinglinie und mittlerer Anodenstrom.- a) Die Schwinglinie von Möller.- b) Die Gleichung der Anodenstrom-Gitterspannungs-Kennlinie...- c) Der Arbeitspunkt Klasse A.- d) Der Arbeitspunkt Klasse B.- e) Der Arbeitspunkt Klasse C.- f) Sonstige Röhreneigenschaften.- 2.6 Vierpolgleichungen und Oszillatorbeziehungen in allgemeiner Form.- a) Vierpolformeln.- b) Der Zusammenhang zwischen Filtern und Oszillatoren.- c) Die Schwingungsformeln eines allgemeinen, passiven Vierpols.- d) Die Schwingstellen eines allgemeinen Vierpols.- e) Die Amplitudenbedingung bei den verschiedenen Schwingstellen.- f) Die Schwingstellen einer Brückenschaltung.- g) Die Arten der Schwingstellen bei einer Brückenschaltung 31 h) Die Schwingstellen eines T-Gliedes.- i) Die Schwingstellen eines ?-Gliedes.- k) Die Schwingungsformel mit zwei Röhren ohne und mit Phase im aktiven Vierpol.- 2.7 Die Rückkopplungsgerade.- 2.8 Das Aktivitätsmaß von Oszillatoren und der Performance Index.- a) Zur Problemstellung.- b) Zur Definition des Aktivitätsmaßes.- c) Formeln für das Aktivitätsmaß.- d) Berechnung des Aktivitätsmaßes einiger Schaltungen.- 2.9 Die Amplitudenbegrenzung.- a) Die Amplitudenbegrenzung durch Audiongleichrichtung.- b) Die Amplitudenbegrenzung durch Gegenkopplung.- c) Die Anwendung von Heiß- und Kaltleitern bei Schwingkreisen.- d) Die Rückkopplungskurve.- 2.10 Der Anschwingvorgang.- 2.11 Die Ersatzschaltungen für Kristalle mit unterteilten Elektroden.- 2.12 Ersatzschaltbilder von Transistoren.- 3 Vierpoltheoretische Betrachtungen.- 3.1 Die Vierpolgrößen beim aktiven Vierpol.- 3.2 Das Ersatzbild eines aktiven Vierpols.- 3.3 Zur Phasendrehung beim Oszillator.- a) Die Phasendrehung der Röhre.- b) Die Phasendrehung durch einen Übertrager.- 3.4 Die Schwingungsbedingung für einen Dreipol.- 3.5 Die drei Schaltmöglichkeiten bei einer Elektronenröhre.- 3.6 Die Darstellung mittels der Kettenmatrix.- 3.7 Die Darstellung der Schwingungsbedingung durch das Betriebsübertragungsmaß.- 3.8 Zur Deutung der Schwingungsgleichungen.- 3.9 Zur Wahl der Abschlußwiderstände.- 3.10 Die Ankopplung des Verbrauchers.- a) Direkte Ankopplung des Verstärkers.- b) Verstärker mit Neutralisation.- 3.11 Der elektronengekoppelte Oszillator.- 3.12 Belastungsunabhängige Oszillatoren.- 3.13 Spezieller belastungsunabhängiger Oszillator.- 4 Die Frequenzkonstanz.- 4.1 Zur Güte von Oszillatoren. Definition der Güte aus der Phasensteilheit.- 4.2 Formeln zur Güteberechnung.- 4.3 Die Gütedefinition aus der Resonanzkurve.- 4.4 Bestimmung der Schwing stellen und der Güte aus der Phase des passiven Vierpols (Filterphase).- a) Brückenoszillator mit Kristallen und Parallelinduktivitäten.- b) Brückenoszillator mit Kristallen ohne Induktivitäten.- c) Brückenoszillator aus einem Phasendrehglied.- d) Güteverbesserung durch Wahl der Dämpfungspole.- e) Güteverbesserung durch Verkleinern der Abschlußwiderstände (Verschieben der Nullstellen).- 4.5 Die Güteerhöhung durch Gegenkopplung.- a) Der Einfluß der Gegenkopplung.- b) Zur Definition von Strom- und Spannungsgegenkopplung.- c) Die Spannungsgegenkopplung durch Parallelwiderstände.- d) Güteerhöhung durch Stromgegenkopplung (Verlustkompensation).- e) Güteerhöhung durch gemischte Gegenkopplung (Verlustkompensation).- f) Güteerhöhung beim Brückenoszillator.- g) Güteerhöhung durch mehrfache Rückkopplung.- 5 Das Stabilitätskriterium nach Nyquist. Verfaßt von Dozent Dr. Lueg, Ulm, Donau.- 5.1 Zur Stabilität.- 5.2 Die komplexe Frequenzebene.- 5.3 Der komplexe Übertragungsfaktor eines allgemeinen linearen Netzwerkes.- a) Definition des komplexen Übertragungsfaktors.- b) Die Knotenanalyse eines linearen, passiven Netzwerkes.- c) Die Knotenanalyse eines linearen, aktiven Netzwerkes.- d) Die Lösung des Systems von Knotengleichungen für komplexe Frequenzen und die daraus folgende Darstellung des Übertragungsfaktors.- 5.4 Die Rückkopplung.- 5.5 Die Entstehung und Anwendung des Nyquist-Diagramms und die Ableitung des Nyquistschen Stabilitätskriteriums.- 5.6 Beispiele zur Anwendung des Nyquist-Diagramms.- 6 Oszillatorschaltungen mit Elektronenröhren.- 6.1 Allgemeines.- 6.2 Der Quarzoszillator von Cady.- 6.3 Die drei Hauptschaltungsmöglichkeiten einer Elektronenröhre.- 6.4 Die induktiv gekoppelte Dreipunktschaltung.- 6.5 Die induktiv gekoppelte Dreipunktschaltung mit Kristall.- 6.6 Die kapazitive Dreipunktschaltung.- 6.7 Die kapazitive Dreipunktschaltung mit Kristall (Heegner-Schaltung).- 6.8 Die Pierce-Miller-Schaltung.- 6.9 Die Pierce-Miller-Schaltung mit alleiniger Induktivität.- 6.10 Die Pierce-Schaltung.- 6.11 Die Güte einer ?-Schaltung bei einseitigem Leerlauf.- 6.12 Die Güte der Pierce-Miller- und der Pierce-Schaltung.- 6.13 Die Meissner-Schaltung mit Kristall.- 6.14 Die Zweiröhren-Heegner-Schaltung.- 6.15 Zweiröhren-Oszillator mit Kristall zwischen den Kathoden.- 6.16 Eine elektronengekoppelte Pierce-Schaltung.- 6.17 Die Meacham-Brücke.- 6.18 Brückenoszillatoren aus Blindwiderständen.- a) Zusammenstellung der Formeln.- b) RC- und RL-Brücken.- c) Schaltungen mit Kreis und Induktivität oder Kapazität.- d) Duale Schaltungen.- e) Schaltungen mit zwei Kreisen.- f) Schaltung mit einem Schwingkristal].- g) Schaltung mit zwei Schwingkristallen.- h) Oszillator mit Kristall und Ferritschwinger.- i) Oszillator mit einem Kristall und Parallelkreisen.- k) Oszillator mit zwei Kristallen und Parallelkreisen.- l) Oszillator mit Kristall mit Reihenkreis und Kristall mit Parallel kreis.- 6.19 Entartete Brücken.- 6.20 Oszillatoren mit Kristallen mit unterteilten Elektroden.- 6.21 Oszillatoren mit Biegungsschwingern.- 6.22 Oszillatoren mit vorgegebenen Betriebseigenschaften.- 6.23 Differenzoszillatoren.- a) Über die Möglichkeiten der gleichzeitigen Erzeugung zweier Frequenzen in einem Oszillator.- b) Über die Konstanz der Differenzfrequenz.- c) Ausgeführte Schaltungen mit zwei gleichzeitigen Frequenzen.- 7 Oszillatorschaltungen mit Transistoren.- 7.1 Allgemeine Formeln für Transistoroszillatoren.- 7.2 Umrechnungsformeln der drei Transistoranordnungen.- 7.3 Die innere Rückkopplung.- 7.4 Der einfachste Transistoroszillator.- 7.5 Zur Erläuterung der inneren Rückkopplung.- 7.6 Zur Berechnung einfacher Transistoroszillatoren.- 7.7 Oszillatoren mit einem frequenzbestimmenden Zweipol.- 7.8 Spitzen- oder Flächentransistoren in der Oszillatorschaltung.- a) Schaltungen mit innerer Rückkopplung.- b) Schaltungen mit äußerer Rückkopplung.- 7.9 Oszillatoren mit zwei frequenzbestimmenden Zweipolen.- a) Mit einem passiven ?-Glied.- b) Mit einem ?-Glied mit Kreisanzapfung.- c) Mit einem passiven T-Glied255.- 7.10 Oszillatoren mit drei frequenzbestimmenden Zweipolen.- 7.11 Oszillator mit einem Kristall und zwei Transistoren.- 7.12 Belastungsunabhängige Transistoroszillatoren.- a) Bedingung für Belastungsunabhängigkeit bei einem Widerstand parallel zum passiven Vierpol.- b) Bedingung für Strom im Belastungswiderstand.- c) Bedingung für Belastungsunabhängigkeit bei einem Widerstand in Reihe zum passiven Vierpol.- d) Oszillator mit zwei belastungsunabhängigen Widerständen.- 8 Die Veränderung der Resonanzfrequenz von Kristalloszillatoren.- 8.1 Über die Veränderungsgrenzen.- a) Das Abreißen der Schwingungen.- b) Das Entstehen unerwünschter Schwingungen.- c) Die Frequenzabhängigkeit des Widerstandes von Kristallen.- d) Der Einfluß der Reihenkapazität.- e) Der Einfluß der Reiheninduktivität.- f) Der Einfluß der Spulenverluste.- g) Die Erweiterung des Frequenzvariationsbereiches.- h) Verstimmen eines Kristalles mit Reiheninduktivität.- i) Das Verhalten eines Kristalls mit Parallelinduktivität.- k) Verstimmen eines Kristalls mit Parallelinduktivität durch eine Kapazität.- 8.2 Schaltungen mit großen Frequenzveränderungsmöglichkeiten.- a) Die Frequenzveränderungen eines Brückenoszillators.- b) Die Frequenzveränderungen einer Pierce-Schaltung.- c) Die Güte bei der Frequenzveränderung von Kristalloszillatoren.- 8.3 Umspringen der Schwingfrequenz und Zieherscheinungen.- a) Zum Umspringen der Schwingfrequenz.- b) Das Ziehen der Schwingfrequenz bei einer Brückenschaltung.- 9 Kristall- und Atomuhren.- 9.1 Die Zeitmessung.- 9.2 Einzelteile und Aufbau einer Quarzuhr.- a) Der Quarz.- b) Sonstige Schaltteile.- c) Die Aufstellung der Kristalluhr.- 9.3 Die Atomuhr.- Literatur.
Details
| Erscheinungsjahr: | 2012 |
|---|---|
| Fachbereich: | Allgemeines |
| Genre: | Technik |
| Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
| Medium: | Taschenbuch |
| Seiten: | 336 |
| Inhalt: |
XI
317 S. 284 Fotos |
| ISBN-13: | 9783642480614 |
| ISBN-10: | 3642480616 |
| Sprache: | Deutsch |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Herzog, W. |
| Auflage: | 1958 |
| Hersteller: |
Springer Berlin
Springer Berlin Heidelberg |
| Maße: | 235 x 155 x 19 mm |
| Von/Mit: | W. Herzog |
| Erscheinungsdatum: | 15.03.2012 |
| Gewicht: | 0,511 kg |
Inhaltsverzeichnis
1 Eigenschaften und Herstellung schwingfähiger Kristalle.- 1.1 Der Piezoeffekt.- 1.2 Das elektrische Ersatzschaltbild des schwingenden Kristalls.- 1.3 Kristalle mit piezoelektrischem Effekt.- 1.4 Kristall und Schaltung.- 2 Zur allgemeinen Theorie der Oszillatoren.- 2.1 Vorbemerkungen.- 2.2 Die Differentialgleichung des Oszillators.- 2.3 Die komplexe Darstellung.- 2.4 Der Zusammenhang über die Schaltung.- 2.5 Der Zusammenhang über die Röhre. Schwinglinie und mittlerer Anodenstrom.- a) Die Schwinglinie von Möller.- b) Die Gleichung der Anodenstrom-Gitterspannungs-Kennlinie...- c) Der Arbeitspunkt Klasse A.- d) Der Arbeitspunkt Klasse B.- e) Der Arbeitspunkt Klasse C.- f) Sonstige Röhreneigenschaften.- 2.6 Vierpolgleichungen und Oszillatorbeziehungen in allgemeiner Form.- a) Vierpolformeln.- b) Der Zusammenhang zwischen Filtern und Oszillatoren.- c) Die Schwingungsformeln eines allgemeinen, passiven Vierpols.- d) Die Schwingstellen eines allgemeinen Vierpols.- e) Die Amplitudenbedingung bei den verschiedenen Schwingstellen.- f) Die Schwingstellen einer Brückenschaltung.- g) Die Arten der Schwingstellen bei einer Brückenschaltung 31 h) Die Schwingstellen eines T-Gliedes.- i) Die Schwingstellen eines ?-Gliedes.- k) Die Schwingungsformel mit zwei Röhren ohne und mit Phase im aktiven Vierpol.- 2.7 Die Rückkopplungsgerade.- 2.8 Das Aktivitätsmaß von Oszillatoren und der Performance Index.- a) Zur Problemstellung.- b) Zur Definition des Aktivitätsmaßes.- c) Formeln für das Aktivitätsmaß.- d) Berechnung des Aktivitätsmaßes einiger Schaltungen.- 2.9 Die Amplitudenbegrenzung.- a) Die Amplitudenbegrenzung durch Audiongleichrichtung.- b) Die Amplitudenbegrenzung durch Gegenkopplung.- c) Die Anwendung von Heiß- und Kaltleitern bei Schwingkreisen.- d) Die Rückkopplungskurve.- 2.10 Der Anschwingvorgang.- 2.11 Die Ersatzschaltungen für Kristalle mit unterteilten Elektroden.- 2.12 Ersatzschaltbilder von Transistoren.- 3 Vierpoltheoretische Betrachtungen.- 3.1 Die Vierpolgrößen beim aktiven Vierpol.- 3.2 Das Ersatzbild eines aktiven Vierpols.- 3.3 Zur Phasendrehung beim Oszillator.- a) Die Phasendrehung der Röhre.- b) Die Phasendrehung durch einen Übertrager.- 3.4 Die Schwingungsbedingung für einen Dreipol.- 3.5 Die drei Schaltmöglichkeiten bei einer Elektronenröhre.- 3.6 Die Darstellung mittels der Kettenmatrix.- 3.7 Die Darstellung der Schwingungsbedingung durch das Betriebsübertragungsmaß.- 3.8 Zur Deutung der Schwingungsgleichungen.- 3.9 Zur Wahl der Abschlußwiderstände.- 3.10 Die Ankopplung des Verbrauchers.- a) Direkte Ankopplung des Verstärkers.- b) Verstärker mit Neutralisation.- 3.11 Der elektronengekoppelte Oszillator.- 3.12 Belastungsunabhängige Oszillatoren.- 3.13 Spezieller belastungsunabhängiger Oszillator.- 4 Die Frequenzkonstanz.- 4.1 Zur Güte von Oszillatoren. Definition der Güte aus der Phasensteilheit.- 4.2 Formeln zur Güteberechnung.- 4.3 Die Gütedefinition aus der Resonanzkurve.- 4.4 Bestimmung der Schwing stellen und der Güte aus der Phase des passiven Vierpols (Filterphase).- a) Brückenoszillator mit Kristallen und Parallelinduktivitäten.- b) Brückenoszillator mit Kristallen ohne Induktivitäten.- c) Brückenoszillator aus einem Phasendrehglied.- d) Güteverbesserung durch Wahl der Dämpfungspole.- e) Güteverbesserung durch Verkleinern der Abschlußwiderstände (Verschieben der Nullstellen).- 4.5 Die Güteerhöhung durch Gegenkopplung.- a) Der Einfluß der Gegenkopplung.- b) Zur Definition von Strom- und Spannungsgegenkopplung.- c) Die Spannungsgegenkopplung durch Parallelwiderstände.- d) Güteerhöhung durch Stromgegenkopplung (Verlustkompensation).- e) Güteerhöhung durch gemischte Gegenkopplung (Verlustkompensation).- f) Güteerhöhung beim Brückenoszillator.- g) Güteerhöhung durch mehrfache Rückkopplung.- 5 Das Stabilitätskriterium nach Nyquist. Verfaßt von Dozent Dr. Lueg, Ulm, Donau.- 5.1 Zur Stabilität.- 5.2 Die komplexe Frequenzebene.- 5.3 Der komplexe Übertragungsfaktor eines allgemeinen linearen Netzwerkes.- a) Definition des komplexen Übertragungsfaktors.- b) Die Knotenanalyse eines linearen, passiven Netzwerkes.- c) Die Knotenanalyse eines linearen, aktiven Netzwerkes.- d) Die Lösung des Systems von Knotengleichungen für komplexe Frequenzen und die daraus folgende Darstellung des Übertragungsfaktors.- 5.4 Die Rückkopplung.- 5.5 Die Entstehung und Anwendung des Nyquist-Diagramms und die Ableitung des Nyquistschen Stabilitätskriteriums.- 5.6 Beispiele zur Anwendung des Nyquist-Diagramms.- 6 Oszillatorschaltungen mit Elektronenröhren.- 6.1 Allgemeines.- 6.2 Der Quarzoszillator von Cady.- 6.3 Die drei Hauptschaltungsmöglichkeiten einer Elektronenröhre.- 6.4 Die induktiv gekoppelte Dreipunktschaltung.- 6.5 Die induktiv gekoppelte Dreipunktschaltung mit Kristall.- 6.6 Die kapazitive Dreipunktschaltung.- 6.7 Die kapazitive Dreipunktschaltung mit Kristall (Heegner-Schaltung).- 6.8 Die Pierce-Miller-Schaltung.- 6.9 Die Pierce-Miller-Schaltung mit alleiniger Induktivität.- 6.10 Die Pierce-Schaltung.- 6.11 Die Güte einer ?-Schaltung bei einseitigem Leerlauf.- 6.12 Die Güte der Pierce-Miller- und der Pierce-Schaltung.- 6.13 Die Meissner-Schaltung mit Kristall.- 6.14 Die Zweiröhren-Heegner-Schaltung.- 6.15 Zweiröhren-Oszillator mit Kristall zwischen den Kathoden.- 6.16 Eine elektronengekoppelte Pierce-Schaltung.- 6.17 Die Meacham-Brücke.- 6.18 Brückenoszillatoren aus Blindwiderständen.- a) Zusammenstellung der Formeln.- b) RC- und RL-Brücken.- c) Schaltungen mit Kreis und Induktivität oder Kapazität.- d) Duale Schaltungen.- e) Schaltungen mit zwei Kreisen.- f) Schaltung mit einem Schwingkristal].- g) Schaltung mit zwei Schwingkristallen.- h) Oszillator mit Kristall und Ferritschwinger.- i) Oszillator mit einem Kristall und Parallelkreisen.- k) Oszillator mit zwei Kristallen und Parallelkreisen.- l) Oszillator mit Kristall mit Reihenkreis und Kristall mit Parallel kreis.- 6.19 Entartete Brücken.- 6.20 Oszillatoren mit Kristallen mit unterteilten Elektroden.- 6.21 Oszillatoren mit Biegungsschwingern.- 6.22 Oszillatoren mit vorgegebenen Betriebseigenschaften.- 6.23 Differenzoszillatoren.- a) Über die Möglichkeiten der gleichzeitigen Erzeugung zweier Frequenzen in einem Oszillator.- b) Über die Konstanz der Differenzfrequenz.- c) Ausgeführte Schaltungen mit zwei gleichzeitigen Frequenzen.- 7 Oszillatorschaltungen mit Transistoren.- 7.1 Allgemeine Formeln für Transistoroszillatoren.- 7.2 Umrechnungsformeln der drei Transistoranordnungen.- 7.3 Die innere Rückkopplung.- 7.4 Der einfachste Transistoroszillator.- 7.5 Zur Erläuterung der inneren Rückkopplung.- 7.6 Zur Berechnung einfacher Transistoroszillatoren.- 7.7 Oszillatoren mit einem frequenzbestimmenden Zweipol.- 7.8 Spitzen- oder Flächentransistoren in der Oszillatorschaltung.- a) Schaltungen mit innerer Rückkopplung.- b) Schaltungen mit äußerer Rückkopplung.- 7.9 Oszillatoren mit zwei frequenzbestimmenden Zweipolen.- a) Mit einem passiven ?-Glied.- b) Mit einem ?-Glied mit Kreisanzapfung.- c) Mit einem passiven T-Glied255.- 7.10 Oszillatoren mit drei frequenzbestimmenden Zweipolen.- 7.11 Oszillator mit einem Kristall und zwei Transistoren.- 7.12 Belastungsunabhängige Transistoroszillatoren.- a) Bedingung für Belastungsunabhängigkeit bei einem Widerstand parallel zum passiven Vierpol.- b) Bedingung für Strom im Belastungswiderstand.- c) Bedingung für Belastungsunabhängigkeit bei einem Widerstand in Reihe zum passiven Vierpol.- d) Oszillator mit zwei belastungsunabhängigen Widerständen.- 8 Die Veränderung der Resonanzfrequenz von Kristalloszillatoren.- 8.1 Über die Veränderungsgrenzen.- a) Das Abreißen der Schwingungen.- b) Das Entstehen unerwünschter Schwingungen.- c) Die Frequenzabhängigkeit des Widerstandes von Kristallen.- d) Der Einfluß der Reihenkapazität.- e) Der Einfluß der Reiheninduktivität.- f) Der Einfluß der Spulenverluste.- g) Die Erweiterung des Frequenzvariationsbereiches.- h) Verstimmen eines Kristalles mit Reiheninduktivität.- i) Das Verhalten eines Kristalls mit Parallelinduktivität.- k) Verstimmen eines Kristalls mit Parallelinduktivität durch eine Kapazität.- 8.2 Schaltungen mit großen Frequenzveränderungsmöglichkeiten.- a) Die Frequenzveränderungen eines Brückenoszillators.- b) Die Frequenzveränderungen einer Pierce-Schaltung.- c) Die Güte bei der Frequenzveränderung von Kristalloszillatoren.- 8.3 Umspringen der Schwingfrequenz und Zieherscheinungen.- a) Zum Umspringen der Schwingfrequenz.- b) Das Ziehen der Schwingfrequenz bei einer Brückenschaltung.- 9 Kristall- und Atomuhren.- 9.1 Die Zeitmessung.- 9.2 Einzelteile und Aufbau einer Quarzuhr.- a) Der Quarz.- b) Sonstige Schaltteile.- c) Die Aufstellung der Kristalluhr.- 9.3 Die Atomuhr.- Literatur.
Details
| Erscheinungsjahr: | 2012 |
|---|---|
| Fachbereich: | Allgemeines |
| Genre: | Technik |
| Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
| Medium: | Taschenbuch |
| Seiten: | 336 |
| Inhalt: |
XI
317 S. 284 Fotos |
| ISBN-13: | 9783642480614 |
| ISBN-10: | 3642480616 |
| Sprache: | Deutsch |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Herzog, W. |
| Auflage: | 1958 |
| Hersteller: |
Springer Berlin
Springer Berlin Heidelberg |
| Maße: | 235 x 155 x 19 mm |
| Von/Mit: | W. Herzog |
| Erscheinungsdatum: | 15.03.2012 |
| Gewicht: | 0,511 kg |
Warnhinweis