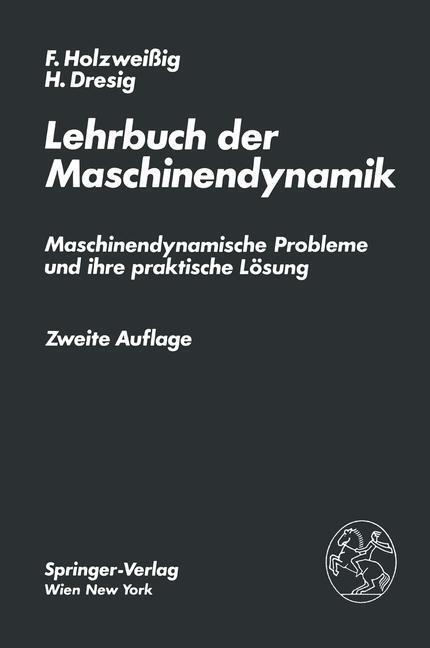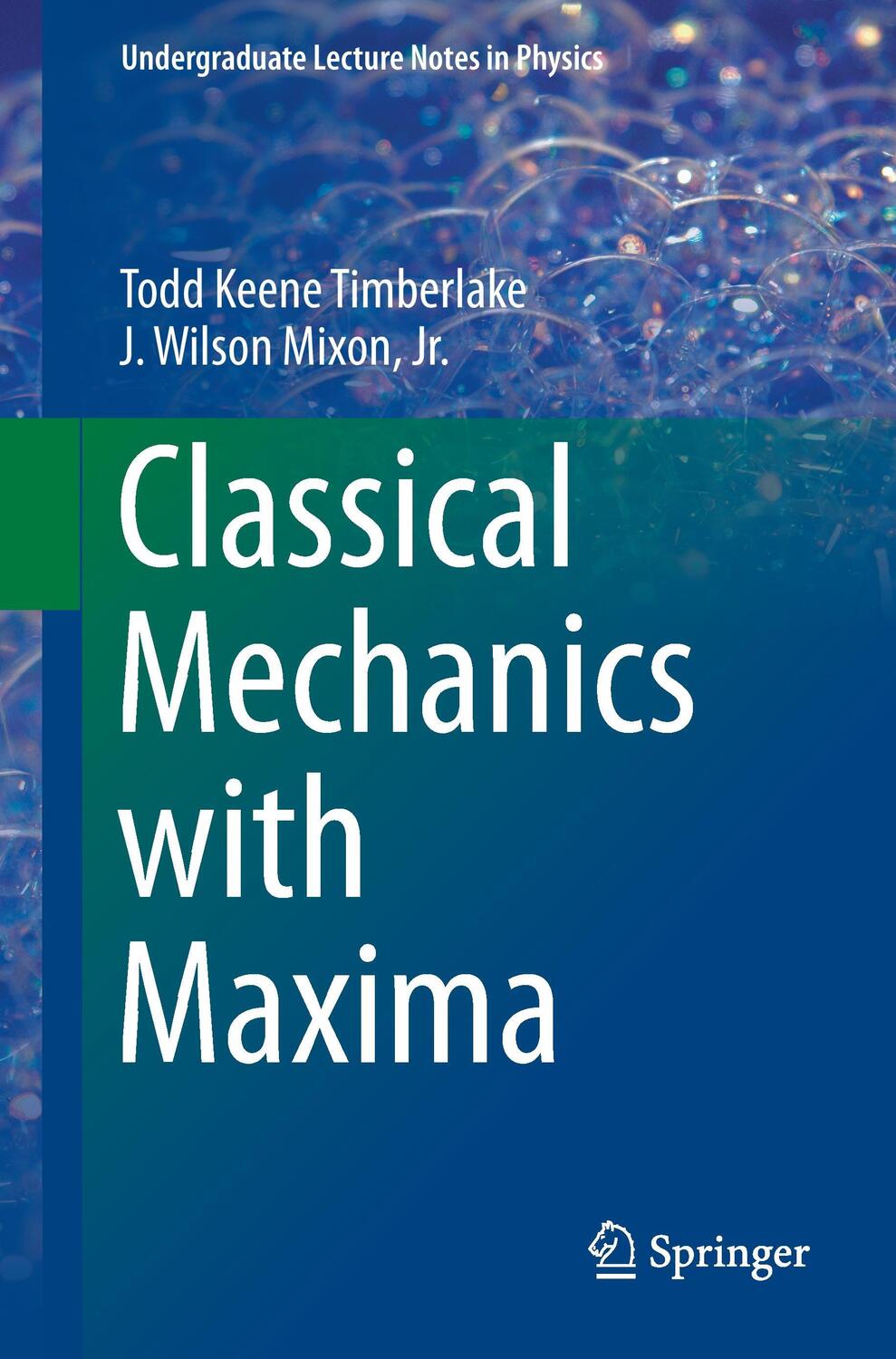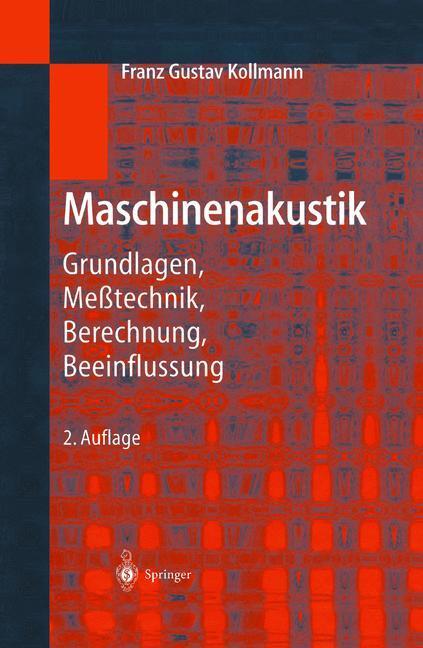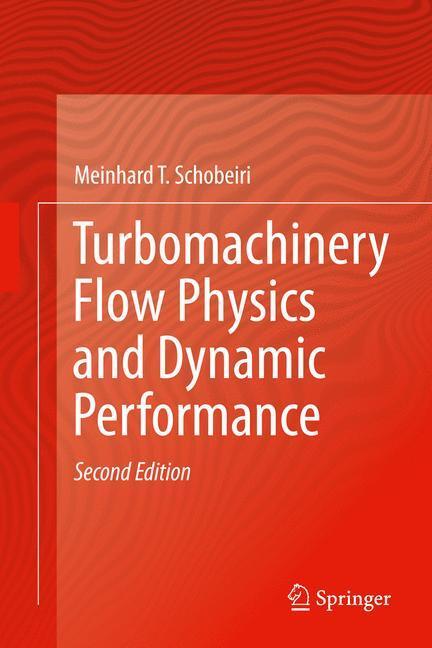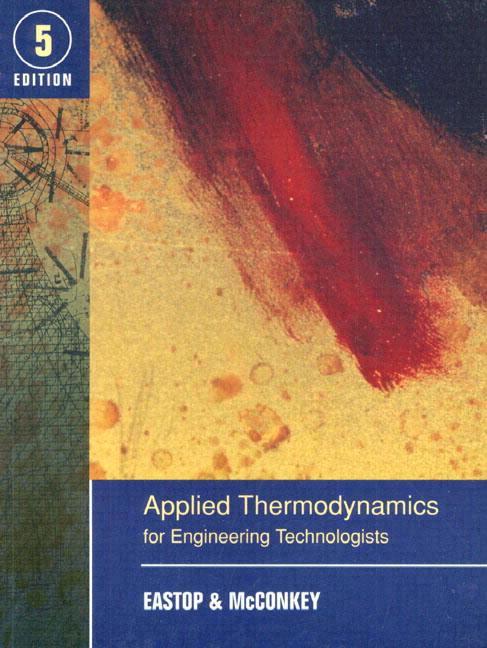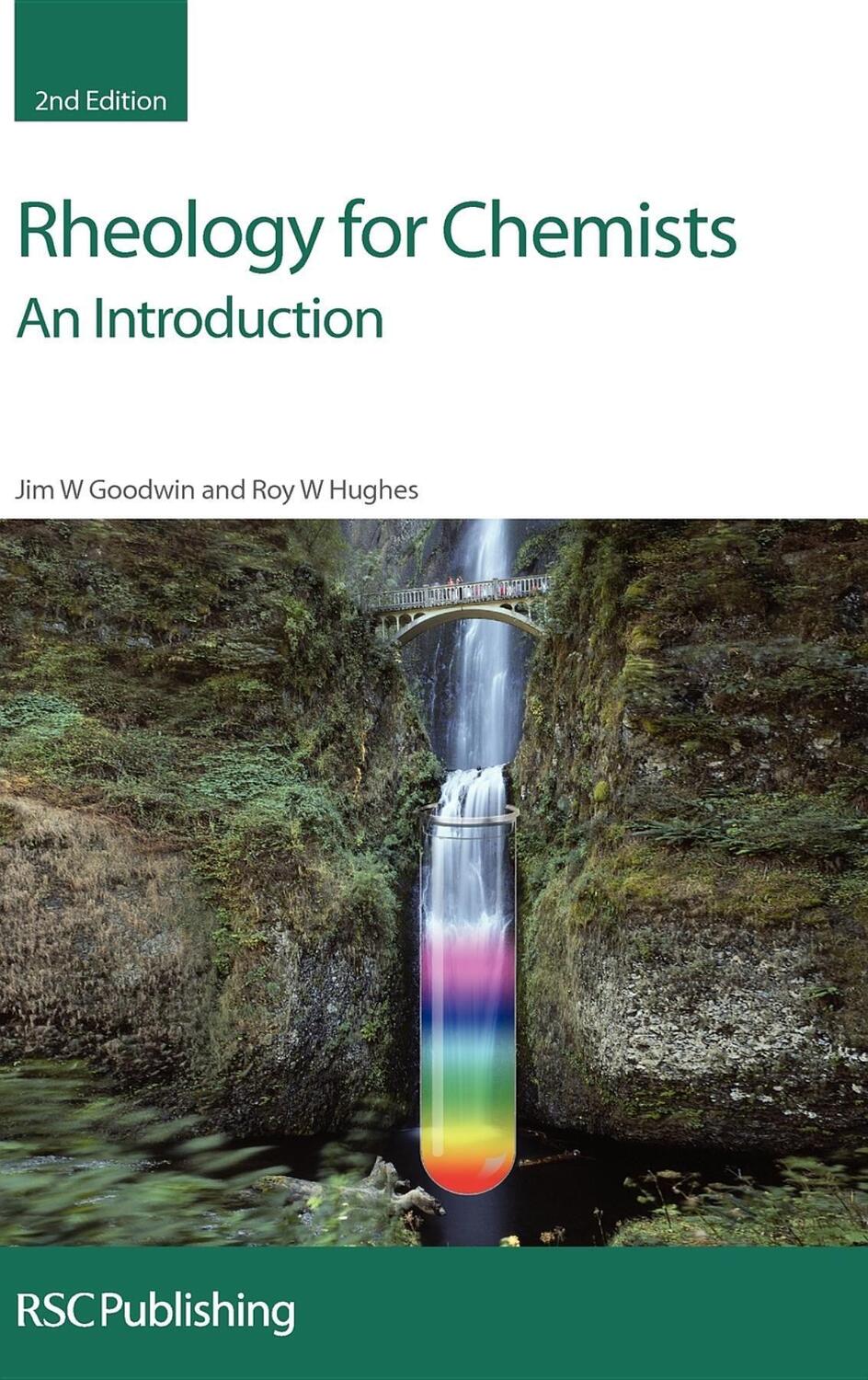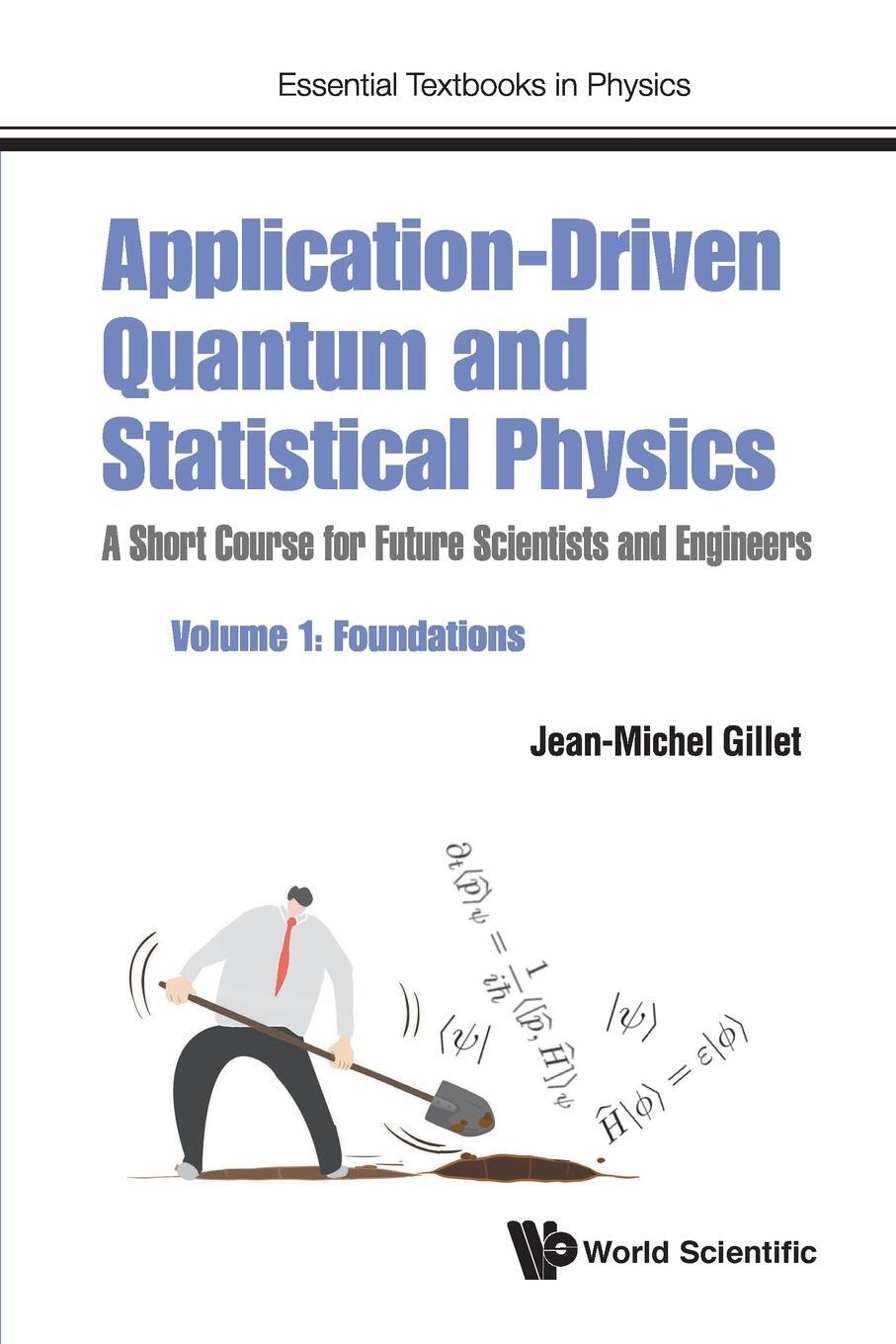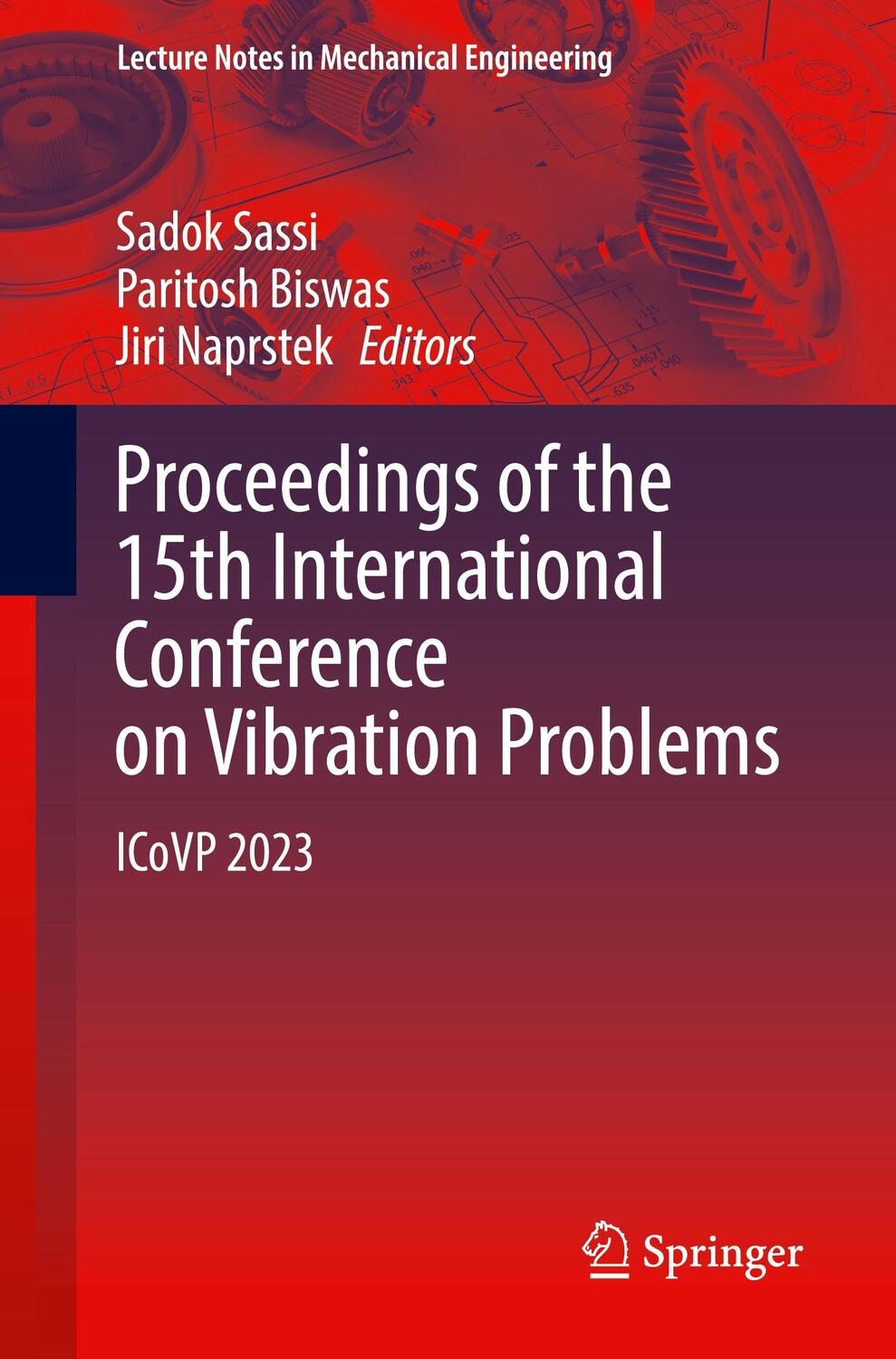Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Deutsch
44,99 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 1-2 Wochen
Kategorien:
Beschreibung
Die Maschinendynamik ist in den Lehrplanen ailer Hochschulfachrichtungen des konstruktiven Maschinenbaus in der Deutschen Demokratischen Republik verankert. Sie baut auf der Technischen Mechanik auf und stellt fUr die Studenten eine unmittel bare Konfrontierung mit typischen dynamischen Problemen ihres Fachgebietes dar. Es handelt sich also urn eine Maschinendynamik, die sowohl dynamische Probleme des Energiemaschinenbaus (Kolbenmaschinen und Turbomaschinen), des Verarbei tungsmaschinenbaus (z. B. Druckmaschinen, Textilmaschinen, Verpackungsma schinen), der Fordergerate, Landmaschinen und Fahrzeuge sowie des Anlagenbaus anspricht. Die bisher vorliegende Literatur auf diesem Gebiet ist entweder zu fachspezifisch oder sie geht zu wenig auf die unmittelbar in der Technischen Mechanik (Grundstudium) vermittelten Kenntnisse ein. In vielen Fallen entspricht sie auch nicht mehr dem praktischen Bedurfnis der Bezugnahme auf EDV-Programme. Diese Lucke soIl das vorliegende Lehrbuch schlieBen und die Briicke zur Spezialliteratur bestimmter Fach richtungen (z. B. Kolben- und Turbomaschinenbau) schlagen. Bei seiner Konzipierung standen wir vor der Wahl, entweder eine allgemeine Schwin gungslehre diskreter linearer Systeme voranzusteilen und dann in A bschnitten der Maschinendynamik darauf zu verweisen oder jeden Abschnitt relativ selbstandig aufzubauen und am SchluB eine allgemein gultige Darstellung im Sinne der Schwtn gungslehre zu geben. Wir haben uns konsequent fUr den zweiten Weg entschieden, obwohl uns diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Den Ausschlag dazu gab die Dberlegung, daB nicht von jedem Maschinenbauingenieur verlangt werden kann, daB er erst dann ein spezieiles Problem anfassen darf, wenn er die Schwingungslehre beherrscht.
Die Maschinendynamik ist in den Lehrplanen ailer Hochschulfachrichtungen des konstruktiven Maschinenbaus in der Deutschen Demokratischen Republik verankert. Sie baut auf der Technischen Mechanik auf und stellt fUr die Studenten eine unmittel bare Konfrontierung mit typischen dynamischen Problemen ihres Fachgebietes dar. Es handelt sich also urn eine Maschinendynamik, die sowohl dynamische Probleme des Energiemaschinenbaus (Kolbenmaschinen und Turbomaschinen), des Verarbei tungsmaschinenbaus (z. B. Druckmaschinen, Textilmaschinen, Verpackungsma schinen), der Fordergerate, Landmaschinen und Fahrzeuge sowie des Anlagenbaus anspricht. Die bisher vorliegende Literatur auf diesem Gebiet ist entweder zu fachspezifisch oder sie geht zu wenig auf die unmittelbar in der Technischen Mechanik (Grundstudium) vermittelten Kenntnisse ein. In vielen Fallen entspricht sie auch nicht mehr dem praktischen Bedurfnis der Bezugnahme auf EDV-Programme. Diese Lucke soIl das vorliegende Lehrbuch schlieBen und die Briicke zur Spezialliteratur bestimmter Fach richtungen (z. B. Kolben- und Turbomaschinenbau) schlagen. Bei seiner Konzipierung standen wir vor der Wahl, entweder eine allgemeine Schwin gungslehre diskreter linearer Systeme voranzusteilen und dann in A bschnitten der Maschinendynamik darauf zu verweisen oder jeden Abschnitt relativ selbstandig aufzubauen und am SchluB eine allgemein gultige Darstellung im Sinne der Schwtn gungslehre zu geben. Wir haben uns konsequent fUr den zweiten Weg entschieden, obwohl uns diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Den Ausschlag dazu gab die Dberlegung, daB nicht von jedem Maschinenbauingenieur verlangt werden kann, daB er erst dann ein spezieiles Problem anfassen darf, wenn er die Schwingungslehre beherrscht.
Inhaltsverzeichnis
0. Aufgaben und Gliederung der Maschinendynamik.- 1. Ermittlung der Kennwerte dynamischer Parameter.- 1.1. Einleitung.- 1.2. Experimentelle Bestimmung von Massenkennwerten.- 1.2.1. Zusammenstellung der Verfahren.- 1.2.2. Statische Verfahren.- 1.2.3. Pendelverfahren.- 1.2.4. Torsionsschwingungsverfahren.- 1.2.5. Bestimmung der Trägheitshauptachsen.- 1.2.6. Hinweise zur Versuchsdurchführung.- 1.3. Berechnung von Federkenn werten.- 1.3.1. Torsionsfederkennwerte und reduzierte Längen.- 1.3.2. Translationsfederkennwerte.- 1.3.3. Gummifedern.- 1.4. Dämpfungsansätze und -kennwerte.- 1.4.1. Einleitung.- 1.4.2. Ansätze für äußere Dämpfungen.- 1.4.3. Werkstück- und Werkstoffdämpf ung.- 1.4.4. Dämpfungskennwerte.- 1.5. Erfassung von Erregerparametern.- 1.5.1. Periodische Erregungen.- 1.5.2. Nichtperiodische Erregungen.- 1.6. Experimentelle Bestimmung von Feder- und Dämpferkennwerten.- 1.6.1. Übersicht.- 1.6.2. Ausschwingversuch.- 1.6.3. Erregte Schwingungen.- 1.6.4. Auswertung mit Hilfe von Ortskurven.- 1.7. Aufgaben A 1/1 bis A 1/5.- 1.8. Lösungen L1/1 bis L1/5.- 2. Dynamik der starren Maschine.- 2.1. Einleitung.- 2.2. Bewegungsgleichung der starren Maschine.- 2.2.1. Grundlegende Zusammenhänge.- 2.2.2. Beispiele.- 2.2.2.1. Hubwerksgetriebe (gleichmäßig übersetzendes Getriebe).- 2.2.2.2. Rapierantrieb einer Webmaschine (ungleichmäßig übersetzendes Getriebe).- 2.2.2.3. Bewegungsgleichung einer Großpresse.- 2.2.3. Aufgaben A 2/1 bis A 2/3.- 2.2.4. Lösungen L 2/1 bis L 2/3.- 2.3. Bewegungszustände der starren Maschine.- 2.3.1. Allgemeines.- 2.3.2. Bewegung bei konservativem Kraftfeld.- 2.3.3. Anlauf- und Bremsvorgänge.- 2.3.4. Stationärer Betriebszustand, Ungleichförmigkeitsgrad und Schwungrad.- 2.3.5. Beispiele.- 2.3.5.1. Winkelabhängiges Antriebsmoment einer Rückholfeder.- 2.3.5.2. Ungleichförmigkeitsgrad einer Presse.- 2.3.6. Aufgabe A 2/4.- 2.3.7. Lösung L 2/4.- 2.4. Bestimmung der Gelenkkräfte und der Fundamentbelastung.- 2.4.1. Technische Aufgabenstellung.- 2.4.2. Berechnung der Lager- und Gelenkkräfte.- 2.4.3. Berechnung der auf das Gestell wirkenden resultierenden Kräfte und Momente.- 2.4.3.1. Allgemeines.- 2.4.3.2. Berechnung der resultierenden Massenkräfte und Massenmomente.- 2.4.4. Beispiele.- 2.4.4.1. Dynamische Gelenkkräfte injeinem Nähmaschinengetriebe.- 2.4.4.2. Webladenantrieb.- 2.4.5. Aufgaben A 2/5 und A 2/6.- 2.4.6. Lösungen L 2/5 und L 2/6.- 2.5. Methoden des Massenausgleichs.- 2.5.1. Aufgabenstellung.- 2.5.2. Auswuchten starrer Rotoren.- 2.5.2.1. Begriffe des Auswuchtens.- 2.5.2.2. Statisches und dynamisches Auswuchten.- 2.5.3. Massenausgleich von Koppelgetrieben.- 2.5.3.1. Vollständiger Ausgleich.- 2.5.3.2. Massenausgleich beim Schubkurbelgetriebe.- 2.5.3.3. Bedingungen für den Ausgleich verschiedener Harmonischer bei Mehr-zylindermaschinen.- 2.5.3.4. Optimaler Massenausgleich.- 2.5.4: Aufgaben A 2/7 und A 2/8.- 2.5.5. Lösungen L 2/7 und L 2/8.- 3. Auistellung der starren Maschine.- 3.1. Aufgabenstellung.- 3.2. Dynamische Grundlagen der Fundamentierung bei periodischer Erregung.- 3.2.1. Minimalmodelle mit periodischer Erregung.- 3.2.1.1. Modellbeschreibung.- 3.2.1.2. Modellberechnung für harmonische Erregung.- 3.2.2. Eigenfrequenzen und Kopplungsfragen des Blockfundamentes mit 6 Freiheitsgraden.- 3.3. Ausführung periodisch erregter Fundamente.- 3.3.1. Blockfundamente.- 3.3.1.1. Ausführungsformen.- 3.3.1.2. Ausführung des Fundamentblockes.- 3.3.1.3. Steifigkeit von Fundamentfederungen.- 3.3.2. Tragkonstruktionen.- 3.3.2.1. Ausführungsformen.- 3.3.2.2. Eigenfrequenzen von Stäben.- 3.4. Fundamente mit Stoßbelastung.- 3.4.1. Modellbeschreibung.- 3.4.2. Dynamische Berechnung.- 3.5. Beurteilungsmaßstäbe.- 3.5.1. Allgemeines.- 3.5.2. Beurteilung der Schwingungseinwirkung auf den Menschen.- 3.5.3. Beurteilung der Schwingungseinwirkung auf Gebäude und Baugrund.- 3.5.4. Beurteilung der Schwingungseinwirkung auf Maschinen.- 3.6. Aufgaben A 3/1 bis A 3/3.- 3.7. Lösungen L 3/1 bis L 3/3.- 4. Torsionsschwingungen in Antriebssystemen.- 4.1. Einleitung.- 4.1.1. Aufgaben und Modelle.- 4.1.2. Das auf eine Welle reduzierte Berechnungsmodell, Bildwelle.- 4.1.3. Reduktion des Kurbeltriebes.- 4.2. Freie Schwingungen diskreter linearer Torsionssysteme.- 4.2.1. Einleitung.- 4.2.1.1. Aufgabenstellung.- 4.2.1.2. Betrachtungen am Minimalmodell.- 4.2.2. Matrizengleichungen für n Freiheitsgrade.- 4.2.3. Prinzipielles zur Lösung der Matrizengleichung.- 4.2.4. Übertragungsmatrizen für freie Schwingungen.- 4.2.5. Abschätzung der niedrigsten Eigenfrequenz.- 4.2.6. Aussagen der freien Schwingungen.- 4.2.7. Aufgaben A 4/1 bis A 4/3.- 4.2.8. Lösungen L 4/1 bis L 4/3.- 4.3. Erzwungene Schwingungen diskreter linearer Torsionssysteme.- 4.3.1. Periodische Erregung.- 4.3.1.1. Aufgabenstellung.- 4.3.1.2. Resonanzschaubild.- 4.3.1.3. Energieverfahren für harmonische Erregung.- 4.3.1.4. Allgemeine Matrizengleichung für harmonische Erregung.- 4.3.1.5. Übertragungsmatrizen für harmonische Erregung.- 4.3.1.6. Gegenüberstellung der Verfahren und Berücksichtigung periodischer Erregung.- 4.3.2. Transiente Erregung.- 4.3.2.1. Aufgabenstellung.- 4.3.2.2. Konstantes und von der Winkelgeschwindigkeit abhängendes Erregermoment.- 4.3.2.3. Zeitabhängiges Erregermoment.- 4.3.3. Aufgaben A 4/4 bis A 4/6.- 4.3.4. Lösungen L 4/4 bis L 4/6.- 4.4. Tilger und Dämpfer in Antriebssystemen.- 4.4.1. Aufgabenstellung.- 4.4.2. Reduktion auf ein Modell mit zwei Freiheitsgraden.- 4.4.3. Auslegung eines linearen Tilgers.- 4.4.4. Auslegung eines federgefesselten Dämpfers.- 4.4.5. Auslegung eines federlosen Dämpfers.- 5. Biegeschwingungen.- 5.1. Zur Entwicklung der Problemstellung.- 5.2. Grundlegende Zusammenhänge.- 5.2.1. Rotierende symmetrische Welle mit Unwuchterregung.- 5.2.2. Kritische Drehzahlen einer mit einer Scheibe besetzten Welle unter Berücksichtigung der Kreiselwirkung.- 5.2.3. Biegeschwingungen mit endlich vielen Freiheitsgraden.- 5.2.4. Beispiel: Müchzentrifuge.- 5.2.5. Aufgaben A 5/1 bis A 5/5.- 5.2.6. Lösungen L 5/1 bis L 5/5.- 5.3. Biegeschwingungen des massebelegten Balkens (Kontinuum).- 5.3.1. Allgemeine Zusammenhänge.- 5.3.2. Prismatischer Balken auf zwei Stützen.- 5.3.3. Eingrenzung der niedrigsten Eigenfrequenzen mit dem Verfahren von Dunkerley.- 5.3.4. Rayleigh-Quotient (Energiemethode).- 5.3.5. Beispiele: Abgesetzter Balken, konische Welle.- 5.3.6. Aufgaben A 5/6 bis A 5/8.- 5.3.7. Lösungen L 5/6 bis L 5/8.- 5.4. Das Verfahren der Übertragungsmatrizen.- 5.4.1. Grundgedanke des Verfahrens.- 5.4.2. Berechnungsbeispiel: Maschinenwelle.- 5.5. Probleme der Modellfindung.- 5.5.1. Zur Erfassung der wesentlichsten Parameter.- 5.5.2. Reduktion des Kontinuums auf ein diskretes Berechnungsmodell.- 5.5.3. Einfluß der Gleitlagerung.- 5.5.4. Beispiele: Auslegereines Tagebau-Großgerätes, Ventilator, Schleifspindel.- 5.5.5. Aufgabe A 5/9.- 5.5.6. Lösung L 5/9.- 6. Schwingungssysteme mit endlich vielen Freiheitsgraden.- 6.1. Einleitung.- 6.2. Bewegungsgleichungen für die freien ungedämpften Schwingungen in Matrizenschreibweise.- 6.2.1. Allgemeine Beziehungen, Ermittlung der Matrizen C, D, M.- 6.2.2. Beispiele zur Aufstellung der Matrizen.- 6.2.3. Aufgaben A 6/1 bis A 6/4.- 6.2.4. Lösungen L 6/1 bis L 6/4.- 6.3. Freie Schwingungen ungedämpfter Systeme.- 6.3.1. Allgemeines.- 6.3.2. Beispiel: Stoß auf ein Gestell.- 6.3.3. Orthogonalität.- 6.3.4. Hauptkoordinaten.- 6.3.5. Aufgaben A 6/5 bis A 6/9.- 6.3.6. Lösungen L 6/5 bis L 6/9.- 6.4. Berechnung der Eigenfrequenzen und Eigenschwingformen.- 6.4.1. Allgemeines.- 6.4.2. Abschätzungen von Dunkerley und Neuher.- 6.4.3. Iterationsverfahren, Rayleigh-Quotient, und Grammel-Quotient.- 6.4.4. Beispiel: Werkzeugmaschinengestelle.- 6.4.5. Aufgaben A 6/10 bis A 6/13.- 6.4.6. Lösungen L 6/10 bis L 6A3.- 6.5. Einfluß von Masse- und Steifigkeitsveränderungen auf die Eigenfrequenzen.- 6.6. Erzwungene Schwingungen ungedämpfter Systeme.- 6.6.1. Einleitung.- 6.6.2. Allgemeine Lösung.- 6.6.3. Harmonische Erregung.- 6.6.4. Belastung durch eine Kraft endlicher Dauer.- 6.6.5. Beispiele: Maschinengestell, Schwingförderer.- 6.6.6. Aufgaben A 6/14 bis A 6/17.- 6.6.7. Lösungen L 6/14 bis L 6/17.- 6.7. Gedämpfte Schwingungen.- 6.7.1. Zur Erfassung der Dämpfung.- 6.7.2. Freie gedämpfte Schwingungen.- 6.7.3. Erzwungene gedämpfte Schwingungen.- 6.7.4. Beispiel: Textilspindel.- 6.7.5. Aufgaben A 6/18 bis A 6/20.- 6.7.6. Lösungen L 6/18 bis L 6/20.- 7. Probleme der Maschinendynamik mit speziellen BewegungsgIeichungen.- 7.1. Charakterisierung durch die Bewegungsgleichung.- 7.2. Probleme, die durch autonome Bewegungsgleichungen beschrieben werden.- 7.3. Probleme, die durch heteronome Bewegungsgleichungen beschrieben werden.- 7.3.1. Erzwungene nichtlineare Schwingungen.- 7.3.2. Parametererregte Schwingungen.- Sachwortverzeichnis.
Details
| Erscheinungsjahr: | 2012 |
|---|---|
| Fachbereich: | Mechanik & Akustik |
| Genre: | Physik |
| Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
| Medium: | Taschenbuch |
| Seiten: | 416 |
| Inhalt: |
412 S.
412 S. 240 Abb. |
| ISBN-13: | 9783709186862 |
| ISBN-10: | 3709186862 |
| Sprache: | Deutsch |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: |
Dresig, H.
Holzweissig, F. |
| Auflage: | 2. Aufl. 1982. Softcover reprint of the original 2nd ed. 1982 |
| Hersteller: |
Springer Wien
Springer Vienna |
| Maße: | 229 x 152 x 23 mm |
| Von/Mit: | H. Dresig (u. a.) |
| Erscheinungsdatum: | 05.01.2012 |
| Gewicht: | 0,6 kg |
Inhaltsverzeichnis
0. Aufgaben und Gliederung der Maschinendynamik.- 1. Ermittlung der Kennwerte dynamischer Parameter.- 1.1. Einleitung.- 1.2. Experimentelle Bestimmung von Massenkennwerten.- 1.2.1. Zusammenstellung der Verfahren.- 1.2.2. Statische Verfahren.- 1.2.3. Pendelverfahren.- 1.2.4. Torsionsschwingungsverfahren.- 1.2.5. Bestimmung der Trägheitshauptachsen.- 1.2.6. Hinweise zur Versuchsdurchführung.- 1.3. Berechnung von Federkenn werten.- 1.3.1. Torsionsfederkennwerte und reduzierte Längen.- 1.3.2. Translationsfederkennwerte.- 1.3.3. Gummifedern.- 1.4. Dämpfungsansätze und -kennwerte.- 1.4.1. Einleitung.- 1.4.2. Ansätze für äußere Dämpfungen.- 1.4.3. Werkstück- und Werkstoffdämpf ung.- 1.4.4. Dämpfungskennwerte.- 1.5. Erfassung von Erregerparametern.- 1.5.1. Periodische Erregungen.- 1.5.2. Nichtperiodische Erregungen.- 1.6. Experimentelle Bestimmung von Feder- und Dämpferkennwerten.- 1.6.1. Übersicht.- 1.6.2. Ausschwingversuch.- 1.6.3. Erregte Schwingungen.- 1.6.4. Auswertung mit Hilfe von Ortskurven.- 1.7. Aufgaben A 1/1 bis A 1/5.- 1.8. Lösungen L1/1 bis L1/5.- 2. Dynamik der starren Maschine.- 2.1. Einleitung.- 2.2. Bewegungsgleichung der starren Maschine.- 2.2.1. Grundlegende Zusammenhänge.- 2.2.2. Beispiele.- 2.2.2.1. Hubwerksgetriebe (gleichmäßig übersetzendes Getriebe).- 2.2.2.2. Rapierantrieb einer Webmaschine (ungleichmäßig übersetzendes Getriebe).- 2.2.2.3. Bewegungsgleichung einer Großpresse.- 2.2.3. Aufgaben A 2/1 bis A 2/3.- 2.2.4. Lösungen L 2/1 bis L 2/3.- 2.3. Bewegungszustände der starren Maschine.- 2.3.1. Allgemeines.- 2.3.2. Bewegung bei konservativem Kraftfeld.- 2.3.3. Anlauf- und Bremsvorgänge.- 2.3.4. Stationärer Betriebszustand, Ungleichförmigkeitsgrad und Schwungrad.- 2.3.5. Beispiele.- 2.3.5.1. Winkelabhängiges Antriebsmoment einer Rückholfeder.- 2.3.5.2. Ungleichförmigkeitsgrad einer Presse.- 2.3.6. Aufgabe A 2/4.- 2.3.7. Lösung L 2/4.- 2.4. Bestimmung der Gelenkkräfte und der Fundamentbelastung.- 2.4.1. Technische Aufgabenstellung.- 2.4.2. Berechnung der Lager- und Gelenkkräfte.- 2.4.3. Berechnung der auf das Gestell wirkenden resultierenden Kräfte und Momente.- 2.4.3.1. Allgemeines.- 2.4.3.2. Berechnung der resultierenden Massenkräfte und Massenmomente.- 2.4.4. Beispiele.- 2.4.4.1. Dynamische Gelenkkräfte injeinem Nähmaschinengetriebe.- 2.4.4.2. Webladenantrieb.- 2.4.5. Aufgaben A 2/5 und A 2/6.- 2.4.6. Lösungen L 2/5 und L 2/6.- 2.5. Methoden des Massenausgleichs.- 2.5.1. Aufgabenstellung.- 2.5.2. Auswuchten starrer Rotoren.- 2.5.2.1. Begriffe des Auswuchtens.- 2.5.2.2. Statisches und dynamisches Auswuchten.- 2.5.3. Massenausgleich von Koppelgetrieben.- 2.5.3.1. Vollständiger Ausgleich.- 2.5.3.2. Massenausgleich beim Schubkurbelgetriebe.- 2.5.3.3. Bedingungen für den Ausgleich verschiedener Harmonischer bei Mehr-zylindermaschinen.- 2.5.3.4. Optimaler Massenausgleich.- 2.5.4: Aufgaben A 2/7 und A 2/8.- 2.5.5. Lösungen L 2/7 und L 2/8.- 3. Auistellung der starren Maschine.- 3.1. Aufgabenstellung.- 3.2. Dynamische Grundlagen der Fundamentierung bei periodischer Erregung.- 3.2.1. Minimalmodelle mit periodischer Erregung.- 3.2.1.1. Modellbeschreibung.- 3.2.1.2. Modellberechnung für harmonische Erregung.- 3.2.2. Eigenfrequenzen und Kopplungsfragen des Blockfundamentes mit 6 Freiheitsgraden.- 3.3. Ausführung periodisch erregter Fundamente.- 3.3.1. Blockfundamente.- 3.3.1.1. Ausführungsformen.- 3.3.1.2. Ausführung des Fundamentblockes.- 3.3.1.3. Steifigkeit von Fundamentfederungen.- 3.3.2. Tragkonstruktionen.- 3.3.2.1. Ausführungsformen.- 3.3.2.2. Eigenfrequenzen von Stäben.- 3.4. Fundamente mit Stoßbelastung.- 3.4.1. Modellbeschreibung.- 3.4.2. Dynamische Berechnung.- 3.5. Beurteilungsmaßstäbe.- 3.5.1. Allgemeines.- 3.5.2. Beurteilung der Schwingungseinwirkung auf den Menschen.- 3.5.3. Beurteilung der Schwingungseinwirkung auf Gebäude und Baugrund.- 3.5.4. Beurteilung der Schwingungseinwirkung auf Maschinen.- 3.6. Aufgaben A 3/1 bis A 3/3.- 3.7. Lösungen L 3/1 bis L 3/3.- 4. Torsionsschwingungen in Antriebssystemen.- 4.1. Einleitung.- 4.1.1. Aufgaben und Modelle.- 4.1.2. Das auf eine Welle reduzierte Berechnungsmodell, Bildwelle.- 4.1.3. Reduktion des Kurbeltriebes.- 4.2. Freie Schwingungen diskreter linearer Torsionssysteme.- 4.2.1. Einleitung.- 4.2.1.1. Aufgabenstellung.- 4.2.1.2. Betrachtungen am Minimalmodell.- 4.2.2. Matrizengleichungen für n Freiheitsgrade.- 4.2.3. Prinzipielles zur Lösung der Matrizengleichung.- 4.2.4. Übertragungsmatrizen für freie Schwingungen.- 4.2.5. Abschätzung der niedrigsten Eigenfrequenz.- 4.2.6. Aussagen der freien Schwingungen.- 4.2.7. Aufgaben A 4/1 bis A 4/3.- 4.2.8. Lösungen L 4/1 bis L 4/3.- 4.3. Erzwungene Schwingungen diskreter linearer Torsionssysteme.- 4.3.1. Periodische Erregung.- 4.3.1.1. Aufgabenstellung.- 4.3.1.2. Resonanzschaubild.- 4.3.1.3. Energieverfahren für harmonische Erregung.- 4.3.1.4. Allgemeine Matrizengleichung für harmonische Erregung.- 4.3.1.5. Übertragungsmatrizen für harmonische Erregung.- 4.3.1.6. Gegenüberstellung der Verfahren und Berücksichtigung periodischer Erregung.- 4.3.2. Transiente Erregung.- 4.3.2.1. Aufgabenstellung.- 4.3.2.2. Konstantes und von der Winkelgeschwindigkeit abhängendes Erregermoment.- 4.3.2.3. Zeitabhängiges Erregermoment.- 4.3.3. Aufgaben A 4/4 bis A 4/6.- 4.3.4. Lösungen L 4/4 bis L 4/6.- 4.4. Tilger und Dämpfer in Antriebssystemen.- 4.4.1. Aufgabenstellung.- 4.4.2. Reduktion auf ein Modell mit zwei Freiheitsgraden.- 4.4.3. Auslegung eines linearen Tilgers.- 4.4.4. Auslegung eines federgefesselten Dämpfers.- 4.4.5. Auslegung eines federlosen Dämpfers.- 5. Biegeschwingungen.- 5.1. Zur Entwicklung der Problemstellung.- 5.2. Grundlegende Zusammenhänge.- 5.2.1. Rotierende symmetrische Welle mit Unwuchterregung.- 5.2.2. Kritische Drehzahlen einer mit einer Scheibe besetzten Welle unter Berücksichtigung der Kreiselwirkung.- 5.2.3. Biegeschwingungen mit endlich vielen Freiheitsgraden.- 5.2.4. Beispiel: Müchzentrifuge.- 5.2.5. Aufgaben A 5/1 bis A 5/5.- 5.2.6. Lösungen L 5/1 bis L 5/5.- 5.3. Biegeschwingungen des massebelegten Balkens (Kontinuum).- 5.3.1. Allgemeine Zusammenhänge.- 5.3.2. Prismatischer Balken auf zwei Stützen.- 5.3.3. Eingrenzung der niedrigsten Eigenfrequenzen mit dem Verfahren von Dunkerley.- 5.3.4. Rayleigh-Quotient (Energiemethode).- 5.3.5. Beispiele: Abgesetzter Balken, konische Welle.- 5.3.6. Aufgaben A 5/6 bis A 5/8.- 5.3.7. Lösungen L 5/6 bis L 5/8.- 5.4. Das Verfahren der Übertragungsmatrizen.- 5.4.1. Grundgedanke des Verfahrens.- 5.4.2. Berechnungsbeispiel: Maschinenwelle.- 5.5. Probleme der Modellfindung.- 5.5.1. Zur Erfassung der wesentlichsten Parameter.- 5.5.2. Reduktion des Kontinuums auf ein diskretes Berechnungsmodell.- 5.5.3. Einfluß der Gleitlagerung.- 5.5.4. Beispiele: Auslegereines Tagebau-Großgerätes, Ventilator, Schleifspindel.- 5.5.5. Aufgabe A 5/9.- 5.5.6. Lösung L 5/9.- 6. Schwingungssysteme mit endlich vielen Freiheitsgraden.- 6.1. Einleitung.- 6.2. Bewegungsgleichungen für die freien ungedämpften Schwingungen in Matrizenschreibweise.- 6.2.1. Allgemeine Beziehungen, Ermittlung der Matrizen C, D, M.- 6.2.2. Beispiele zur Aufstellung der Matrizen.- 6.2.3. Aufgaben A 6/1 bis A 6/4.- 6.2.4. Lösungen L 6/1 bis L 6/4.- 6.3. Freie Schwingungen ungedämpfter Systeme.- 6.3.1. Allgemeines.- 6.3.2. Beispiel: Stoß auf ein Gestell.- 6.3.3. Orthogonalität.- 6.3.4. Hauptkoordinaten.- 6.3.5. Aufgaben A 6/5 bis A 6/9.- 6.3.6. Lösungen L 6/5 bis L 6/9.- 6.4. Berechnung der Eigenfrequenzen und Eigenschwingformen.- 6.4.1. Allgemeines.- 6.4.2. Abschätzungen von Dunkerley und Neuher.- 6.4.3. Iterationsverfahren, Rayleigh-Quotient, und Grammel-Quotient.- 6.4.4. Beispiel: Werkzeugmaschinengestelle.- 6.4.5. Aufgaben A 6/10 bis A 6/13.- 6.4.6. Lösungen L 6/10 bis L 6A3.- 6.5. Einfluß von Masse- und Steifigkeitsveränderungen auf die Eigenfrequenzen.- 6.6. Erzwungene Schwingungen ungedämpfter Systeme.- 6.6.1. Einleitung.- 6.6.2. Allgemeine Lösung.- 6.6.3. Harmonische Erregung.- 6.6.4. Belastung durch eine Kraft endlicher Dauer.- 6.6.5. Beispiele: Maschinengestell, Schwingförderer.- 6.6.6. Aufgaben A 6/14 bis A 6/17.- 6.6.7. Lösungen L 6/14 bis L 6/17.- 6.7. Gedämpfte Schwingungen.- 6.7.1. Zur Erfassung der Dämpfung.- 6.7.2. Freie gedämpfte Schwingungen.- 6.7.3. Erzwungene gedämpfte Schwingungen.- 6.7.4. Beispiel: Textilspindel.- 6.7.5. Aufgaben A 6/18 bis A 6/20.- 6.7.6. Lösungen L 6/18 bis L 6/20.- 7. Probleme der Maschinendynamik mit speziellen BewegungsgIeichungen.- 7.1. Charakterisierung durch die Bewegungsgleichung.- 7.2. Probleme, die durch autonome Bewegungsgleichungen beschrieben werden.- 7.3. Probleme, die durch heteronome Bewegungsgleichungen beschrieben werden.- 7.3.1. Erzwungene nichtlineare Schwingungen.- 7.3.2. Parametererregte Schwingungen.- Sachwortverzeichnis.
Details
| Erscheinungsjahr: | 2012 |
|---|---|
| Fachbereich: | Mechanik & Akustik |
| Genre: | Physik |
| Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
| Medium: | Taschenbuch |
| Seiten: | 416 |
| Inhalt: |
412 S.
412 S. 240 Abb. |
| ISBN-13: | 9783709186862 |
| ISBN-10: | 3709186862 |
| Sprache: | Deutsch |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: |
Dresig, H.
Holzweissig, F. |
| Auflage: | 2. Aufl. 1982. Softcover reprint of the original 2nd ed. 1982 |
| Hersteller: |
Springer Wien
Springer Vienna |
| Maße: | 229 x 152 x 23 mm |
| Von/Mit: | H. Dresig (u. a.) |
| Erscheinungsdatum: | 05.01.2012 |
| Gewicht: | 0,6 kg |
Warnhinweis