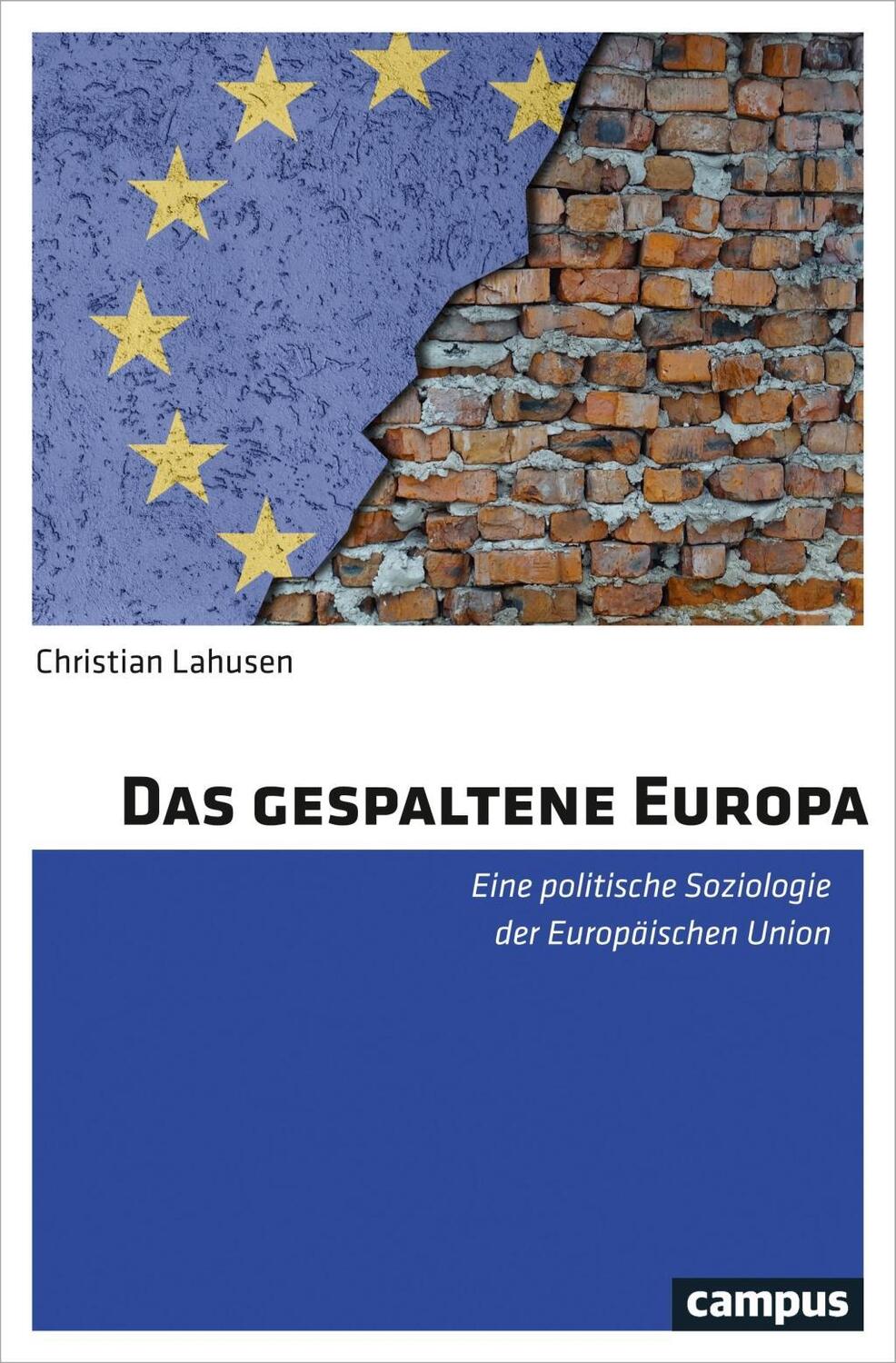Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Deutsch
39,95 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Aktuell nicht verfügbar
Kategorien:
Beschreibung
1 Zur politischen Soziologie Europas
Der europäische Integrationsprozess hat eine Vielzahl von Veränderungen mit sich gebracht, die Frieden, Wohlstand und Freizügigkeit für eine wachsende Zahl von Mitgliedsländern und ihre Bevölkerungen bringen sollten. Das Abkommen von Schengen hat zum Abbau von Grenzkontrollen geführt, der Reisen erleichtert und die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf Arbeit, Ausbildung und Freizeit erhöht. Der Binnenmarkt hat den Warenaustausch innerhalb Europas angetrieben und damit Arbeits- und Produktionsformen sowie Konsumgewohnheiten verändert. Und schließlich hat die gemeinsame Währung den Kapital- und Zahlungsverkehr für Unternehmen und Privatleute innerhalb von wie auch zwischen den Ländern vereinheitlicht und vereinfacht. Als Segnungen der Europäischen Union propagiert, sind diese Errungenschaften jedoch unter dem Eindruck der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise und der hohen Fluchtmigration im Laufe der 2010er Jahre zusehends zum Gegenstand massiver öffentlicher Kritik geworden. Der Schengener Raum wird für Probleme unkontrollierter Zuwanderung und öffentlicher Sicherheit verantwortlich gemacht, der Binnenmarkt und der Euro für einen Verdrängungswettbewerb zulasten schwächerer Volkswirtschaften, für steigende Staatsschulden und den Rückbau des Wohlfahrtsstaates. Mehr denn je wird über die künftige Ausgestaltung der EU gestritten, denn europakritische Parteien und Gruppierungen mobilisieren sehr erfolgreich gegen die EU und gegen pro-europäisch gesinnte Regierungen in den verschiedenen Mitgliedsländern.
'Unpolitisch' war das europäische Projekt nie, denn in den zurückliegenden 60 Jahren haben die Europäischen Gemeinschaften (EG) und die spätere Europäische Union (EU) immer wieder politische Kontroversen in den Mitgliedsländern entfacht. Dies war immer dann der Fall, wenn die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten zu Volksbefragungen eingeladen wurde, um darüber abzustimmen, ob sie den Beitritt ihres Landes zur EG/EU befürworten, ob sie europarechtliche Verträge (bspw. die Einheitliche Europäische Akte von 1986 oder den Maastrichter Vertrag von 1992) unterstützen oder den ausgearbeiteten Vorschlag für eine Europäische Verfassung begrüßen (2005). Die europäischen Institutionen und die proeuropäischen Regierungen der betreffenden Mitgliedsländer haben bei diesen Anlässen nicht immer die gewünschten Ergebnisse erzielt, denn einige dieser integrationspolitischen Vorhaben wurden abgelehnt.
Wird dem Tenor der politikwissenschaftlichen Forschung gefolgt, ist das europäische Integrationsprojekt einer stetigen 'Politisierung' unterworfen worden (Hooghe und Marks 2009; Wilde und Zürn 2012; Rauh und Zürn 2014). Vor allem in den ersten Jahrzehnten seiner 60-jährigen Geschichte hatte die Bevölkerung dem europäischen Integrationsprozess noch Desinteresse oder Gleichgültigkeit entgegengebracht (Lindberg und Scheingold 1970; Hix 1999: 135). So wurde zwar viel politische Arbeit in die Etablierung der Europäischen Gemeinschaften und der späteren Europäischen Union investiert: Völkerrechtliche Verträge mussten verhandelt und verabschiedet, Organe (Kommission, Parlament, Ministerrat, Europäische Gerichte, Agenturen etc.) eingerichtet, besetzt und finanziert, zahlreiche Einzelentscheidungen in einer wachsenden Zahl von Politikbereichen auf den Weg gebracht und in nationales Recht überführt werden. Allerdings lag diese Arbeit in den Händen von beruflich damit betrauten Personen (Politikern, Ministerialbeamten, Experten, Interessenvertretern etc.). Die europapolitischen Auseinandersetzungen und Verhandlungen, die der Konstruktion 'Europas' den Weg bereiteten, waren somit weitestgehend auf die politischen, administrativen und wirtschaftlichen Eliten sowie auf thematisch einschlägige Publizisten, Experten und Wissenschaftler beschränkt (Haller 2009; Genschel und Jachtenfuchs 2013). Die europäische Bürgerschaft schien sich bis in die 1990er Jahre in Schweigen zu hüllen. Diese öffentliche Tolerierung der Euro
Der europäische Integrationsprozess hat eine Vielzahl von Veränderungen mit sich gebracht, die Frieden, Wohlstand und Freizügigkeit für eine wachsende Zahl von Mitgliedsländern und ihre Bevölkerungen bringen sollten. Das Abkommen von Schengen hat zum Abbau von Grenzkontrollen geführt, der Reisen erleichtert und die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf Arbeit, Ausbildung und Freizeit erhöht. Der Binnenmarkt hat den Warenaustausch innerhalb Europas angetrieben und damit Arbeits- und Produktionsformen sowie Konsumgewohnheiten verändert. Und schließlich hat die gemeinsame Währung den Kapital- und Zahlungsverkehr für Unternehmen und Privatleute innerhalb von wie auch zwischen den Ländern vereinheitlicht und vereinfacht. Als Segnungen der Europäischen Union propagiert, sind diese Errungenschaften jedoch unter dem Eindruck der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise und der hohen Fluchtmigration im Laufe der 2010er Jahre zusehends zum Gegenstand massiver öffentlicher Kritik geworden. Der Schengener Raum wird für Probleme unkontrollierter Zuwanderung und öffentlicher Sicherheit verantwortlich gemacht, der Binnenmarkt und der Euro für einen Verdrängungswettbewerb zulasten schwächerer Volkswirtschaften, für steigende Staatsschulden und den Rückbau des Wohlfahrtsstaates. Mehr denn je wird über die künftige Ausgestaltung der EU gestritten, denn europakritische Parteien und Gruppierungen mobilisieren sehr erfolgreich gegen die EU und gegen pro-europäisch gesinnte Regierungen in den verschiedenen Mitgliedsländern.
'Unpolitisch' war das europäische Projekt nie, denn in den zurückliegenden 60 Jahren haben die Europäischen Gemeinschaften (EG) und die spätere Europäische Union (EU) immer wieder politische Kontroversen in den Mitgliedsländern entfacht. Dies war immer dann der Fall, wenn die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten zu Volksbefragungen eingeladen wurde, um darüber abzustimmen, ob sie den Beitritt ihres Landes zur EG/EU befürworten, ob sie europarechtliche Verträge (bspw. die Einheitliche Europäische Akte von 1986 oder den Maastrichter Vertrag von 1992) unterstützen oder den ausgearbeiteten Vorschlag für eine Europäische Verfassung begrüßen (2005). Die europäischen Institutionen und die proeuropäischen Regierungen der betreffenden Mitgliedsländer haben bei diesen Anlässen nicht immer die gewünschten Ergebnisse erzielt, denn einige dieser integrationspolitischen Vorhaben wurden abgelehnt.
Wird dem Tenor der politikwissenschaftlichen Forschung gefolgt, ist das europäische Integrationsprojekt einer stetigen 'Politisierung' unterworfen worden (Hooghe und Marks 2009; Wilde und Zürn 2012; Rauh und Zürn 2014). Vor allem in den ersten Jahrzehnten seiner 60-jährigen Geschichte hatte die Bevölkerung dem europäischen Integrationsprozess noch Desinteresse oder Gleichgültigkeit entgegengebracht (Lindberg und Scheingold 1970; Hix 1999: 135). So wurde zwar viel politische Arbeit in die Etablierung der Europäischen Gemeinschaften und der späteren Europäischen Union investiert: Völkerrechtliche Verträge mussten verhandelt und verabschiedet, Organe (Kommission, Parlament, Ministerrat, Europäische Gerichte, Agenturen etc.) eingerichtet, besetzt und finanziert, zahlreiche Einzelentscheidungen in einer wachsenden Zahl von Politikbereichen auf den Weg gebracht und in nationales Recht überführt werden. Allerdings lag diese Arbeit in den Händen von beruflich damit betrauten Personen (Politikern, Ministerialbeamten, Experten, Interessenvertretern etc.). Die europapolitischen Auseinandersetzungen und Verhandlungen, die der Konstruktion 'Europas' den Weg bereiteten, waren somit weitestgehend auf die politischen, administrativen und wirtschaftlichen Eliten sowie auf thematisch einschlägige Publizisten, Experten und Wissenschaftler beschränkt (Haller 2009; Genschel und Jachtenfuchs 2013). Die europäische Bürgerschaft schien sich bis in die 1990er Jahre in Schweigen zu hüllen. Diese öffentliche Tolerierung der Euro
1 Zur politischen Soziologie Europas
Der europäische Integrationsprozess hat eine Vielzahl von Veränderungen mit sich gebracht, die Frieden, Wohlstand und Freizügigkeit für eine wachsende Zahl von Mitgliedsländern und ihre Bevölkerungen bringen sollten. Das Abkommen von Schengen hat zum Abbau von Grenzkontrollen geführt, der Reisen erleichtert und die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf Arbeit, Ausbildung und Freizeit erhöht. Der Binnenmarkt hat den Warenaustausch innerhalb Europas angetrieben und damit Arbeits- und Produktionsformen sowie Konsumgewohnheiten verändert. Und schließlich hat die gemeinsame Währung den Kapital- und Zahlungsverkehr für Unternehmen und Privatleute innerhalb von wie auch zwischen den Ländern vereinheitlicht und vereinfacht. Als Segnungen der Europäischen Union propagiert, sind diese Errungenschaften jedoch unter dem Eindruck der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise und der hohen Fluchtmigration im Laufe der 2010er Jahre zusehends zum Gegenstand massiver öffentlicher Kritik geworden. Der Schengener Raum wird für Probleme unkontrollierter Zuwanderung und öffentlicher Sicherheit verantwortlich gemacht, der Binnenmarkt und der Euro für einen Verdrängungswettbewerb zulasten schwächerer Volkswirtschaften, für steigende Staatsschulden und den Rückbau des Wohlfahrtsstaates. Mehr denn je wird über die künftige Ausgestaltung der EU gestritten, denn europakritische Parteien und Gruppierungen mobilisieren sehr erfolgreich gegen die EU und gegen pro-europäisch gesinnte Regierungen in den verschiedenen Mitgliedsländern.
'Unpolitisch' war das europäische Projekt nie, denn in den zurückliegenden 60 Jahren haben die Europäischen Gemeinschaften (EG) und die spätere Europäische Union (EU) immer wieder politische Kontroversen in den Mitgliedsländern entfacht. Dies war immer dann der Fall, wenn die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten zu Volksbefragungen eingeladen wurde, um darüber abzustimmen, ob sie den Beitritt ihres Landes zur EG/EU befürworten, ob sie europarechtliche Verträge (bspw. die Einheitliche Europäische Akte von 1986 oder den Maastrichter Vertrag von 1992) unterstützen oder den ausgearbeiteten Vorschlag für eine Europäische Verfassung begrüßen (2005). Die europäischen Institutionen und die proeuropäischen Regierungen der betreffenden Mitgliedsländer haben bei diesen Anlässen nicht immer die gewünschten Ergebnisse erzielt, denn einige dieser integrationspolitischen Vorhaben wurden abgelehnt.
Wird dem Tenor der politikwissenschaftlichen Forschung gefolgt, ist das europäische Integrationsprojekt einer stetigen 'Politisierung' unterworfen worden (Hooghe und Marks 2009; Wilde und Zürn 2012; Rauh und Zürn 2014). Vor allem in den ersten Jahrzehnten seiner 60-jährigen Geschichte hatte die Bevölkerung dem europäischen Integrationsprozess noch Desinteresse oder Gleichgültigkeit entgegengebracht (Lindberg und Scheingold 1970; Hix 1999: 135). So wurde zwar viel politische Arbeit in die Etablierung der Europäischen Gemeinschaften und der späteren Europäischen Union investiert: Völkerrechtliche Verträge mussten verhandelt und verabschiedet, Organe (Kommission, Parlament, Ministerrat, Europäische Gerichte, Agenturen etc.) eingerichtet, besetzt und finanziert, zahlreiche Einzelentscheidungen in einer wachsenden Zahl von Politikbereichen auf den Weg gebracht und in nationales Recht überführt werden. Allerdings lag diese Arbeit in den Händen von beruflich damit betrauten Personen (Politikern, Ministerialbeamten, Experten, Interessenvertretern etc.). Die europapolitischen Auseinandersetzungen und Verhandlungen, die der Konstruktion 'Europas' den Weg bereiteten, waren somit weitestgehend auf die politischen, administrativen und wirtschaftlichen Eliten sowie auf thematisch einschlägige Publizisten, Experten und Wissenschaftler beschränkt (Haller 2009; Genschel und Jachtenfuchs 2013). Die europäische Bürgerschaft schien sich bis in die 1990er Jahre in Schweigen zu hüllen. Diese öffentliche Tolerierung der Euro
Der europäische Integrationsprozess hat eine Vielzahl von Veränderungen mit sich gebracht, die Frieden, Wohlstand und Freizügigkeit für eine wachsende Zahl von Mitgliedsländern und ihre Bevölkerungen bringen sollten. Das Abkommen von Schengen hat zum Abbau von Grenzkontrollen geführt, der Reisen erleichtert und die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf Arbeit, Ausbildung und Freizeit erhöht. Der Binnenmarkt hat den Warenaustausch innerhalb Europas angetrieben und damit Arbeits- und Produktionsformen sowie Konsumgewohnheiten verändert. Und schließlich hat die gemeinsame Währung den Kapital- und Zahlungsverkehr für Unternehmen und Privatleute innerhalb von wie auch zwischen den Ländern vereinheitlicht und vereinfacht. Als Segnungen der Europäischen Union propagiert, sind diese Errungenschaften jedoch unter dem Eindruck der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise und der hohen Fluchtmigration im Laufe der 2010er Jahre zusehends zum Gegenstand massiver öffentlicher Kritik geworden. Der Schengener Raum wird für Probleme unkontrollierter Zuwanderung und öffentlicher Sicherheit verantwortlich gemacht, der Binnenmarkt und der Euro für einen Verdrängungswettbewerb zulasten schwächerer Volkswirtschaften, für steigende Staatsschulden und den Rückbau des Wohlfahrtsstaates. Mehr denn je wird über die künftige Ausgestaltung der EU gestritten, denn europakritische Parteien und Gruppierungen mobilisieren sehr erfolgreich gegen die EU und gegen pro-europäisch gesinnte Regierungen in den verschiedenen Mitgliedsländern.
'Unpolitisch' war das europäische Projekt nie, denn in den zurückliegenden 60 Jahren haben die Europäischen Gemeinschaften (EG) und die spätere Europäische Union (EU) immer wieder politische Kontroversen in den Mitgliedsländern entfacht. Dies war immer dann der Fall, wenn die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten zu Volksbefragungen eingeladen wurde, um darüber abzustimmen, ob sie den Beitritt ihres Landes zur EG/EU befürworten, ob sie europarechtliche Verträge (bspw. die Einheitliche Europäische Akte von 1986 oder den Maastrichter Vertrag von 1992) unterstützen oder den ausgearbeiteten Vorschlag für eine Europäische Verfassung begrüßen (2005). Die europäischen Institutionen und die proeuropäischen Regierungen der betreffenden Mitgliedsländer haben bei diesen Anlässen nicht immer die gewünschten Ergebnisse erzielt, denn einige dieser integrationspolitischen Vorhaben wurden abgelehnt.
Wird dem Tenor der politikwissenschaftlichen Forschung gefolgt, ist das europäische Integrationsprojekt einer stetigen 'Politisierung' unterworfen worden (Hooghe und Marks 2009; Wilde und Zürn 2012; Rauh und Zürn 2014). Vor allem in den ersten Jahrzehnten seiner 60-jährigen Geschichte hatte die Bevölkerung dem europäischen Integrationsprozess noch Desinteresse oder Gleichgültigkeit entgegengebracht (Lindberg und Scheingold 1970; Hix 1999: 135). So wurde zwar viel politische Arbeit in die Etablierung der Europäischen Gemeinschaften und der späteren Europäischen Union investiert: Völkerrechtliche Verträge mussten verhandelt und verabschiedet, Organe (Kommission, Parlament, Ministerrat, Europäische Gerichte, Agenturen etc.) eingerichtet, besetzt und finanziert, zahlreiche Einzelentscheidungen in einer wachsenden Zahl von Politikbereichen auf den Weg gebracht und in nationales Recht überführt werden. Allerdings lag diese Arbeit in den Händen von beruflich damit betrauten Personen (Politikern, Ministerialbeamten, Experten, Interessenvertretern etc.). Die europapolitischen Auseinandersetzungen und Verhandlungen, die der Konstruktion 'Europas' den Weg bereiteten, waren somit weitestgehend auf die politischen, administrativen und wirtschaftlichen Eliten sowie auf thematisch einschlägige Publizisten, Experten und Wissenschaftler beschränkt (Haller 2009; Genschel und Jachtenfuchs 2013). Die europäische Bürgerschaft schien sich bis in die 1990er Jahre in Schweigen zu hüllen. Diese öffentliche Tolerierung der Euro
Details
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
|---|---|
| Medium: | Taschenbuch |
| Seiten: | 318 |
| Inhalt: |
318 S.
4 Tab. 9 Grafiken Diagramme Schaubilder |
| ISBN-13: | 9783593510460 |
| ISBN-10: | 3593510464 |
| Sprache: | Deutsch |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Lahusen, Christian |
| Auflage: | 1/2019 |
| campus verlag: | Campus Verlag |
| Maße: | 214 x 142 x 20 mm |
| Von/Mit: | Christian Lahusen |
| Erscheinungsdatum: | 10.01.2019 |
| Gewicht: | 0,409 kg |
Details
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
|---|---|
| Medium: | Taschenbuch |
| Seiten: | 318 |
| Inhalt: |
318 S.
4 Tab. 9 Grafiken Diagramme Schaubilder |
| ISBN-13: | 9783593510460 |
| ISBN-10: | 3593510464 |
| Sprache: | Deutsch |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Lahusen, Christian |
| Auflage: | 1/2019 |
| campus verlag: | Campus Verlag |
| Maße: | 214 x 142 x 20 mm |
| Von/Mit: | Christian Lahusen |
| Erscheinungsdatum: | 10.01.2019 |
| Gewicht: | 0,409 kg |
Warnhinweis